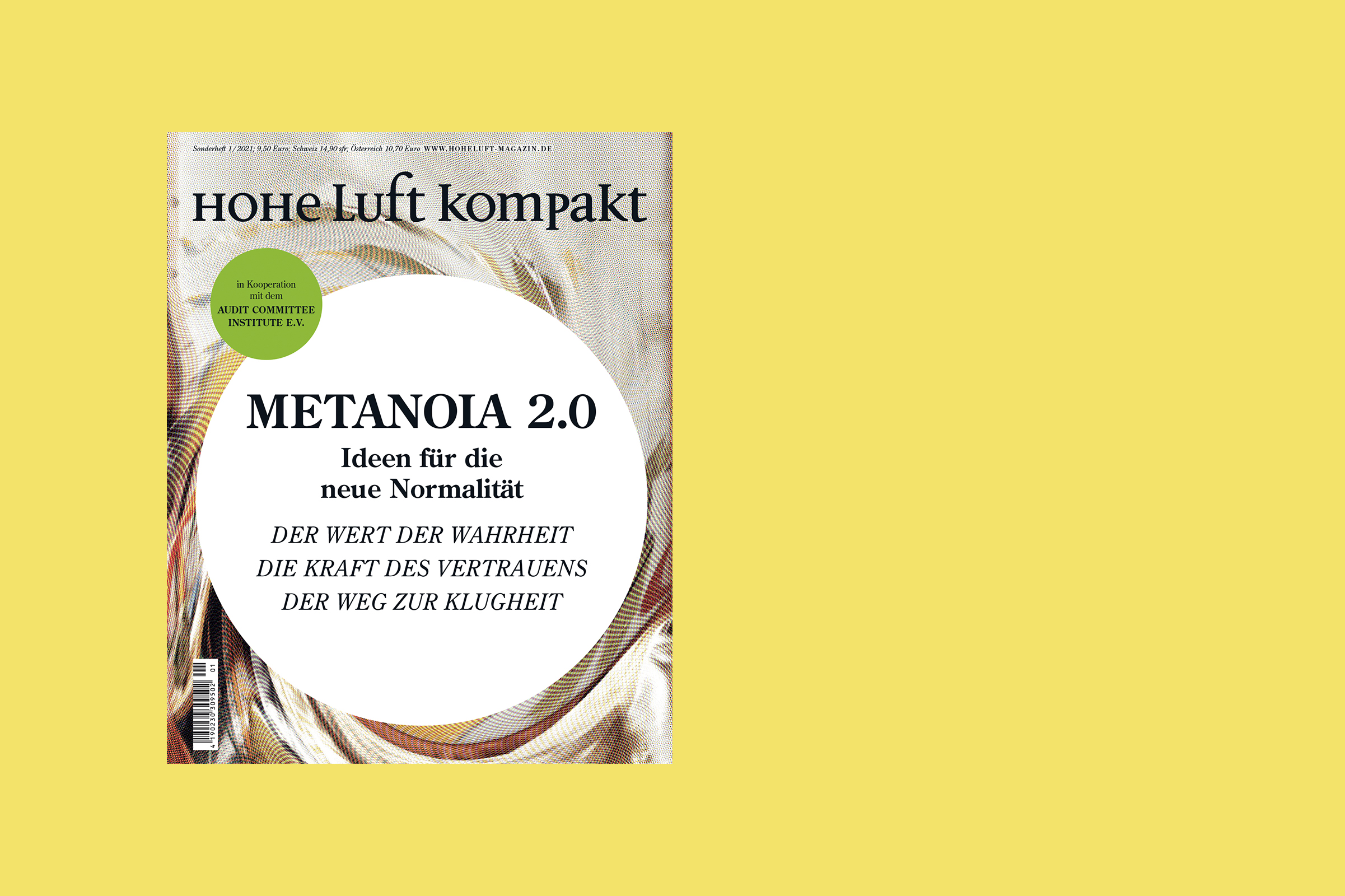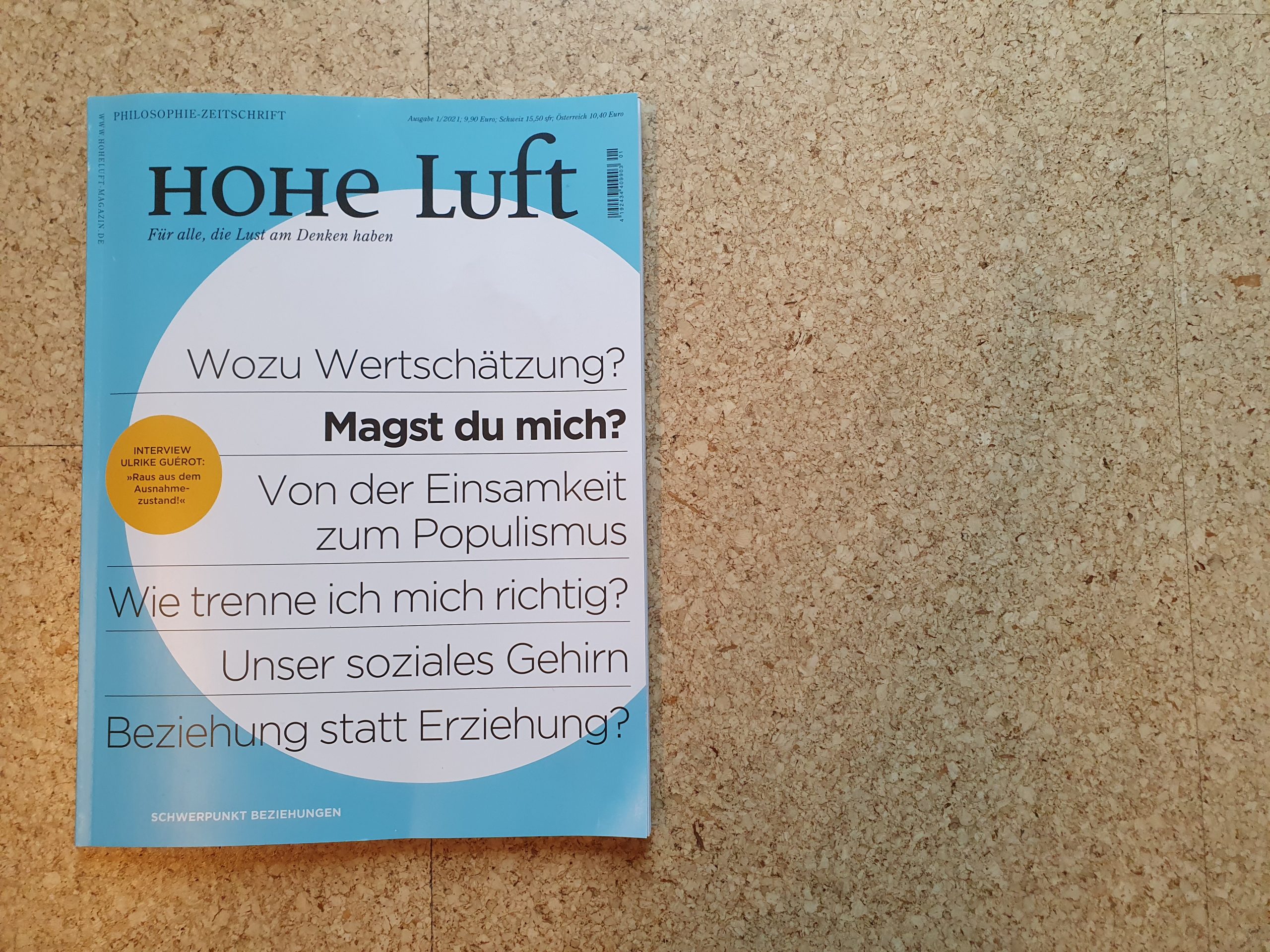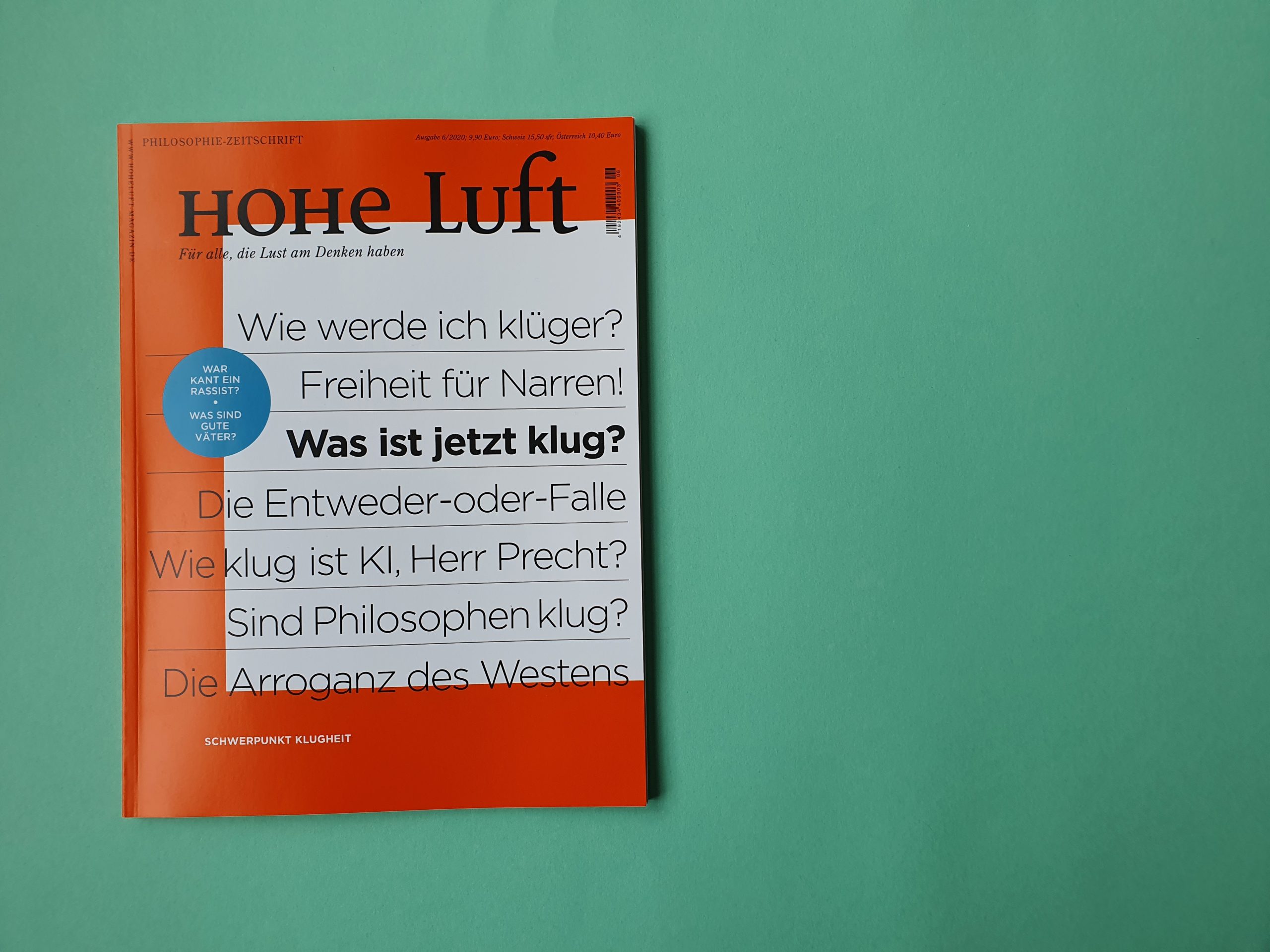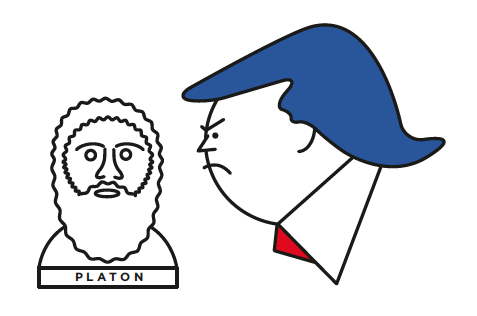Metanoia 2.0 – Ideen für die neue Normalität
Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind unüberschaubar und machen strukturelle Veränderungen notwendig: remote work, neue digitale Führungsstile, eine neue Unternehmenskultur und Governanceethik. Die Krise macht nicht nur die Bruchstellen globalen Ökonomie sichtbar. Sie zeigt uns auch, dass wir ein ganz neues Verständnis von Wirtschaft und Unternehmensführung brauchen, das auf den Notwendigkeiten von Klimaschutz, Komplexitätsbewältigung und gesellschaftlicher Verantwortung beruht. Covid-19 zwingt mehr denn je zur inneren Umkehr, zu einer Neuorientierung im Denken. Nach unserem letzten HOHE LUFT kompakt-Sonderheft (»Metanoia – Führen in Zeiten des Wandels«) wollen wir daher mit METANOIA 2.0 – IDEEN FÜR DIE NEUE NORMALITÄT erneut den Austausch zwischen Ökonomie und Philosophie fördern. „Wahrheit – Vertrauen – Klugheit“ sind die Schwerpunkte, die wir gemeinsam mit dem Audit Committee Institute e. V. – einer mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft assoziierten Plattform für Aufsichtsräte und Führungskräfte vor allem börsennotierter Gesellschaften – konzipiert haben. Es geht um die großen ökonomischen und sozialen Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft: Worin liegt jetzt Wert von Wahrheit und Transparenz? Inwieweit braucht ein funktionierendes Wirtschaftssystem Vertrauen? Wer entwickelt und bestimmt die Regeln …