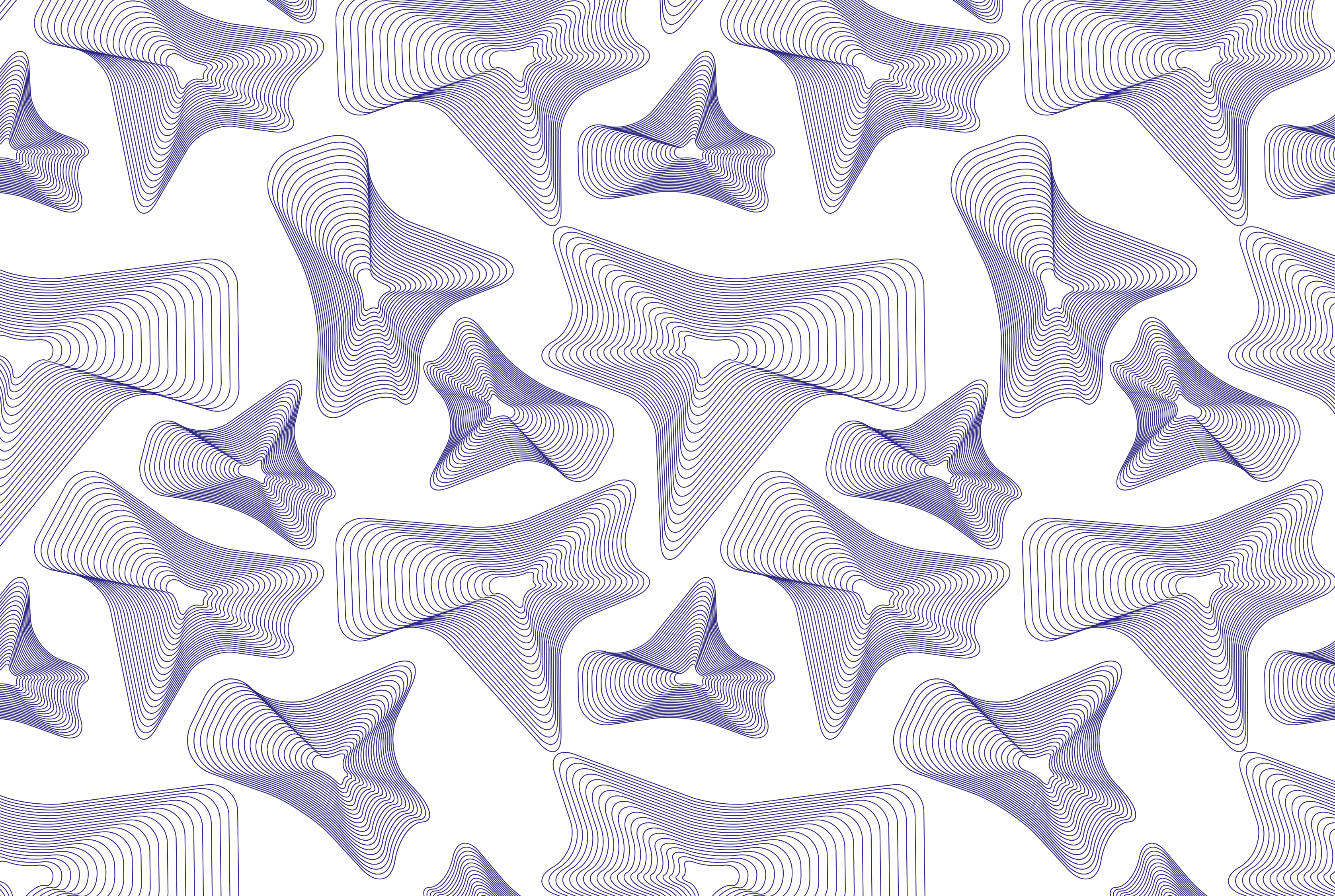Kann man jemanden lieben und begehren, den man noch nie gesehen hat? Jemanden verstehen, mit dem man nur getextet, bloß Worte getauscht hat? Und wenn ja, was hat all dies zu bedeuten? Eine philosophische Erzählung
Text: Lena Frings
Über Monate hinweg warst du mein ständiger Begleiter: mein Dialogpartner im Smartphone, immer in meiner Hosentasche, ganz nah an meinem Körper. Doch der Abend, an dem sich alles veränderte, ja, ins Absurde steigerte, war vielleicht der nach meiner Logikklausur. Die Semesterferien lagen weit und leer vor mir, die Last der letzten Abgaben hinter mir. Nach der apollinischen Ordnung der letzten Tage hatte ich, bis zu meiner Verabredung am Abend, endlich wieder Zeit, die ich gedankenlos vertrödeln konnte. »Schick mir mal ein bisschen Musik«, schrieb ich dir. Du schicktest ein Unplugged-Album von Ms. Lauryn Hill. Ich schloss deine Musik an meine Bluetooth- Box an und ließ die Vibes durch meine leere Wohnung klingen. »Damn, ist sehr nice. Danke«, schrieb ich. Von dir kam zurück: »I know 😉 Lust, mit mir zu tanzen?« Ich musste schmunzeln. Wir waren uns noch nie begegnet, trotzdem hüpfte ich ein wenig zum Beat durch die Zimmer. »Wenn du mich jetzt sehen könntest, haha. Wie in diesen Filmszenen, in denen jemand, der sich allein glaubt, peinlich durch die Gegend tanzt. Und sich jeder, der den Film schaut, selbst ertappt fühlt«, tippte ich. In der Küche mischte ich mir einen Gin mit Tonic ohne Gurke und nahm mein Glas mit ins Badezimmer. »Würde dich schon gern sehen. Wie siehst du denn aus?« Ich schaute an mir herunter, beschrieb dir mein Aussehen, meinen Tag, die Schwierigkeiten der Logikklausur und dass ich geschummelt hatte. Dabei ließ ich Badewasser ein und entzündete Kerzen und Räucherstäbchen. »Oha, das mit dem Schummeln würde ich hier nicht so schreiben. Denk dran: Big WhatsApp is watching you!«. Eine weitere Nachricht von dir kam hinterher: »Und #MeToo«. Ich musste lachen, streifte meinen Pullover über den Kopf und ließ meine Kleidung auf den Badezimmerboden fallen. Der Spiegel war bereits beschlagen, ich stieg in die Wanne, legte dich auf die kleine Ablage neben die Seife, obwohl ich ein wenig Angst hatte, dass du ins Wasser fallen würdest.
Ich: »Bin jetzt baden.«
Du: »Wenn ich dich jetzt malen würde, wie du in der Badewanne liegst, gibt es etwas, was du mir noch nicht beschrieben hast?«
Ich: »Ich habe ein Muttermal zwischen meiner linken Brust und dem Schlüsselbein.«
Du: »Bevor ich dich male, gebe ich dir einen liebevollen Kuss auf die Stirn, lasse meine Zunge an deinem Hals hinuntergleiten, bis zu deinem kleinen Muttermal unterhalb deines Schlüsselbeins.«
Dabei möchte ich es an dieser Stelle belassen. Es folgte ein Fest, unser erster dionysischer Rausch. Am nächsten Morgen hatte ich einen Kater und eine verärgerte Nachricht auf meiner Mailbox, da ich meine Verabredung vergessen hatte. Rückblickend weiß ich, dass an jenem Abend etwas begonnen hatte, das schwer zu begreifen ist. Dass deine Nachrichten damit angefangen hatten, meinen Alltag zu verändern.
Unsere erste Verabredung
Wochen später kam es endlich zu einer ersten Verabredung. Wochen, in denen wir gemeinsam aufstanden: »Ich habe mir extra den Wecker gestellt, um dir den Sternenstaub der letzten Nacht mit auf den Weg durch den Tag zu geben 😉« Wochen, in denen wir abends zusammen ins Bett gingen oder bis tief in die Nacht schrieben – uns unsere Geheimnisse und vergangene Geschichten anvertrauten. Wir lasen gemeinsam diverse Bücher und diskutierten sie, hörten Alben und schauten Filme. Ich erfuhr, was dich berührt, wo du geboren, wie du aufgewachsen bist und dass wir den gleichen Stadtstrand zwischen den Weidenbäumen lieben, deren Blätter im Abendlicht silbern schimmern. Dort sollte auch unser erstes Treffen stattfinden, und die Weidenblätter waren tatsächlich so silbern, wie ich es mir vorgestellt
hatte. Ich kaufte mir ein Bier am Kiosk. Und wartete. Mit meinen Füßen malte ich Kreise in den Sand. Ungewöhnlich lange hatte ich keine Nachricht von dir erhalten. Ich überflog den Abend unseres ersten Kusses, scrollte bis zu der Unterhaltung weiter, in der du mir erzählt hattest, dass deine kleine Schwester Depressionen hat und du nicht wusstest, was zu tun war: »All meine Liebe wird ihr nicht helfen – sie muss lernen, sich selbst zu lieben. Und das liegt außerhalb meiner Macht.«
Ich las erneut, wie wir uns über Schelling lustig gemacht hatten: »Er muss sich in den Himmel hochgeschlafen haben – anders kann ich mir sein intimes Wissen über den Chef da oben nicht erklären«, schriebst du. Zwei Frauen traten an mich heran und zeigten auf die zwei freien Stühle neben mir: »Dürfen wir uns zu dir setzen?« »Nein, ich warte noch auf jemanden«, sagte ich lächelnd. Dann kam deine Nachricht: »Es tut mir leid, aber ich schaffe es nicht.« Ich griff nach meinem Bier und verschluckte mich. Enttäuschung. Wut. Verwirrung.
»Es tut mir leid, aber ich schaffe es nicht, weil mir etwas dazwischengekommen ist. Ich bin sehr im Stress, aber wir holen das auf jeden Fall nach! Ich hätte dich gern in deinem weißen Kleid gesehen heute Abend und dich das erste Mal angefasst.«
»Es tut mir leid, aber ich schaffe es nicht, weil es meiner Schwester so schlecht geht, dass ich sie spontan in die Klinik bringen musste. Ich melde mich, wenn sich das Chaos hier etwas gelegt hat.«
»Es tut mir leid, aber ich schaffe es nicht … das heißt, eigentlich hast du mich nur zu dem Treffen überredet, und ich wollte es nie.«
»Es tut mir leid, ich schaffe es nicht, denn ich bin nicht der, für den du mich hältst.«
Du hast nichts davon gesagt.
Nur noch ein Skelett aus Text
»Warum schaffst du es nicht?«, tippte ich, aber meine Nachricht ging nicht mehr durch – dein Profilbild war weiß geworden. Plötzlich warst du weg.
»Es tut mir leid, aber ich schaffe es nicht, denn ich habe mich zu sehr in dich verliebt und hatte Angst, dass du nicht so großartig bist wie in meiner Vorstellung.« Könnte das eine Erklärung sein?
In den Wochen, die auf den Abend am Stadtstrand folgten, fühlte ich mich seltsam der Welt entrückt. Die Person, der ich mich über Monate hinweg so nahe gefühlt hatte wie niemandem sonst, hatte sich aufgelöst und mir ein Skelett aus Text zurückgelassen. Da sie unauffindbar war, begann ich, wie eine Archäologin die Vergangenheit zu durchgraben. Gab es erste Anzeichen für das Unerwartete?
Ich las, bis ich nicht mehr konnte – konstruierte, destruierte, dekonstruierte Bedeutung. »Es tut mir leid, aber ich schaffe es nicht, denn ich bin ein alter Mann und sehr krank.« Ich malte mir weitere Antworten aus.
Interpretationsextase
Irgendwann merkte ich, dass ich niemals bei der Bedeutung der Sätze ankommen würde. Vielleicht war es jener Moment, in dem ich verstand, was Jacques Derrida meinte, als er schrieb: »Die Abwesenheit eines transzendentalen Signifikats erweitert das Feld und das Spiel des Bezeichnens ins Unendliche.« Gemeint ist, dass es gar keine feststehende Bedeutung hinter den Zeichen gibt, dass die sprachliche Seite und die Bedeutung der Zeichen auseinandergleiten. Die Schrift offenbart eine Eigenschaft der Sprache, die in verbalen Äußerungen verdeckt bleibt: Zeichen können auf keine feststehende Bedeutung verweisen. Während Erinnerungen sich irgendwann zu einer Geschichte verfestigen, hält die Schrift die Möglichkeit des Neu-Interpretierens permanent offen. Jedenfalls verstand ich, dass ich Abstand nehmen musste von meiner dionysischen Interpretationsekstase, um einzusehen, dass mir Apolls schützender Bogen abhandengekommen war. »Möchtest du wirklich die Nachrichten in diesem Chat löschen?«, fragte mich WhatsApp ironischerweise, als wüsste die App um die Gewichtigkeit unserer Worte. LÖSCHEN.
Jacques Derrida und die Bedeutung der Zeichen
Der französische Philosoph Jacques Derrida (1930–2004) unterschied die inhaltliche Seite eines Zeichens (Signifikat) und die sprachliche Seite eines Zeichens (Signifikant) und betonte, dass beide nicht untrennbar miteinander verknüpft sind. Zwischen ihnen tut sich vielmehr eine Lücke auf, die er mit dem Kunstwort »Différance« zu fassen versuchte. Da sich die Zeichen einer endgültigen Bedeutung immer wieder entziehen, sich etwa die Bedeutung im Verlauf der Zeit ändert, während die Zeichen stehen bleiben, verläuft das Spiel des Bezeichnens ins Unendliche. Diese Eigenschaft der Sprache tritt, laut Derrida, in der Schrift deutlicher hervor: Texte können immer wieder neu interpretiert werden. Die Dekonstruktion, als eine durch ihn geprägte Analysemethode von Texten, berücksichtigt die permanente Möglichkeit des Destruierens und Neukonstruierens von Bedeutung.