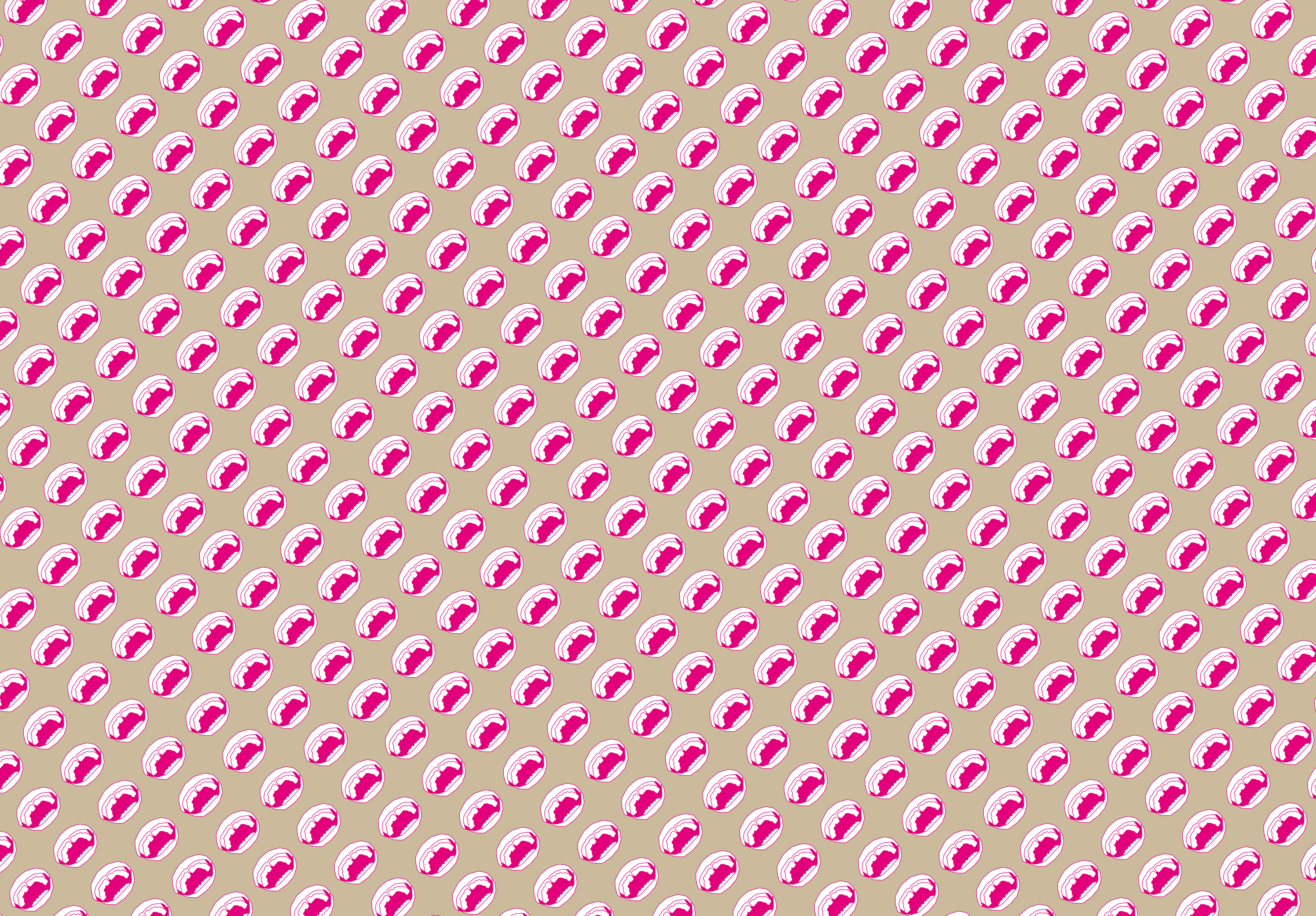Noch nie war die sexuelle Freiheit so groß. Aber was ist überhaupt Sex? Was heißt es, guten Sex zu haben? Und was bedeutet das für unser monogames Beziehungsmodell?
Text: Thomas Vašek
Sex ist überall, in allen Variationen. Man kann ihn kaufen, einschlägige Klubs besuchen oder sich im Netz spontan dazu verabreden. Und wenn einem das zu kompliziert ist, macht man es sich einfach selbst. So frei wie heute war der Sex noch nie. Ob hetero oder schwul, bi- oder pansexuell, monogam oder promiskuitiv: Alles geht. Erlaubt ist, was gefällt, mit den Ausnahmen sexuelle Gewalt, Inzest und Pädophilie. Ansonsten kann jeder Sex haben – nach eigenen Neigungen, nach eigenem Geschmack. Heutige Sexratgeber geben keine Unterweisungen mehr, geschweige denn moralische Belehrungen, eher empfiehlt man Mut zur Grenzverletzung, zum fantasievollen, tabulosen Spiel.
Die sexuelle Revolution hat uns von vielen ungesunden Zwängen befreit. Aber die grenzenlose Freiheit wirft auch neue Fragen auf. Sie alle haben zu tun mit der Bedeutung des Sex für unser Leben, für unsere Beziehungen mit anderen. Was drückt Sex eigentlich aus? Was ist guter Sex, im qualitativen wie im moralischen Sinn? Und ist es in Ordnung, sexuelle Beziehungen mit mehreren Partnern zu haben?
Die Philosophen haben den Sex lange Zeit ignoriert oder abgewertet, das Thema überließ man den Schriftstellern und Dichtern.
Um mit der Vielfalt sexueller Optionen zurande zu kommen, brauchen wir nicht einfach nur mehr Sex. Was wir brauchen, das ist ein neues, ein tieferes Verständnis davon, was Sex eigentlich ist – und was es heißt, guten Sex zu haben. Das sind keine therapeutischen, sondern philosophische Fragen. Es geht um Begriffe, um Werte, um Sinn. Die Philosophen haben den Sex lange Zeit ignoriert oder abgewertet, das Thema überließ man den Schriftstellern und Dichtern. Statt mit Orgasmen und Oralsex beschäftigte man sich lieber mit Metaphysik und Erkenntnistheorie. Der Grund liegt in einer jahrhundertelangen leibfeindlichen Tradition. Platon hielt den Körper für das Gefängnis der Seele. Körperliche Triebe, so dachte der Philosoph, verwirren nur den Verstand. Als philosophisches Ideal galt ihm die rein geistige »Liebe zum Schönen«.
Kirchenvater Augustinus (354 – 430) verdammte die Fleischeslust, die den Menschen nur von der wahren Liebe abbringe, von der Liebe zu Gott. In seinen Bekenntnissen flehte er den Allmächtigen an, ihn vom Vogelleim des Gelüsts zu befreien. Der Scholastiker Thomas von Aquin (1225 –1274) verurteilte jeglichen unnatürlichen Sex, der nicht der Fortpflanzung dient, damit schuf er die Grundlage der kirchlichen Sexualmoral. Auch Kant lehnte Sex zum puren Vergnügen ab, genauso wie die Selbstbefriedigung. Die Masturbation hielt er für eine unter das Vieh herabwürdigende Behandlung der eigenen Person.
Die Zeit ist über diese Vorstellungen großteils hinweggegangen. Seit Freud wissen wir, dass die Unterdrückung des Sexualtriebs zu seelischen Krankheiten führt. Die 68er- Bewegung hat die alte Sexualmoral aufgebrochen. Es gibt die Pille und Kondome. Niemand fühlt sich mehr schuldig, weil er oder sie masturbiert – oder einfach nur extravagante sexuelle Wünsche hat. Die sexuelle Befreiung der 60er-Jahre erlaubte es auch den Philosophen, ungezwungener über Sex nachzudenken. Doch dabei stießen sie auf unerwartete Schwierigkeiten. Schon die Definition, was Sex überhaupt ist, steckt voller Tücken. Eine sexuelle Handlung, so könnte man denken, erfordert den Kontakt mit den Geschlechtsorganen. Aber bekanntlich können auch andere Körperteile sexuelle Lust vermitteln. Zugleich muss Kontakt mit den Geschlechtsteilen nicht sexuell sein, man denke an gynokologische Untersuchungen. Eine andere m gliche Definition wäre, sexuelle Handlungen zu bestimmen als Handlungen mit Fortpflanzungspotenzial. Aber dann wäre etwa Oralsex nicht als Sex zu qualifizieren, und genauso wenig natürlich Masturbation oder gleichgeschlechtlicher Sex.
Eine mögliche Alternative wäre, eine sexuelle Handlung zu definieren als Handlung, die sexuelle Lust erzeugt. Aber auch diese Definition scheitert. Viele sexuelle Handlungen erzeugen keine Lust, man denke an langweiligen Routinesex. Genauso wenig erfordert Sex offenbar sexuelles Verlangen. Eine Prostituierte, die ihren Kunden oral befriedigt, tut das in der Regel nicht, weil sie sexuelles Verlangen danach hat, sondern um Geld damit zu verdienen. Die physischen Eigenschaften allein machen eine Handlung also noch nicht zum sexuellen Akt. Menschliche Handlungen sind »polysem«, sie können verschiedene Bedeutungen tragen. Die Berührung eines Arms kann ebenso eine freundschaftliche Geste sein wie eine sexuelle Annäherung. Viele Philosophen sehen Sex heute – in der Tradition von Michel Foucault (1926 –1984) – als soziales und historisches Konstrukt. Was wir unter Sex verstehen, hängt ab von sozialen Erwartungen, Machtverhältnissen und Normen, die sich verändern können. Küssen etwa halten viele jüngere Menschen heute gar nicht mehr für Sex. Und bei manchen neuen Praktiken ist noch gar nicht klar, wie man sie qualifizieren soll – man denke etwa an berührungslosen Telefon- und Cybersex oder an Sexting, den Austausch sexueller Botschaften per Mobiltelefon. Für den Hausgebrauch könnten wir Sex vielleicht bestimmen als intimen zwischenmenschlichen Körperkontakt, der eine lustvolle Komponente hat – und Varianten wie Masturbation oder Fetischismus, die ohne Partner auskommen, einfach einmal ausklammern. Aber das beantwortet noch nicht die Frage, was Sex eigentlich ist.
Es geht um Vertrauen und Verletzlichkeit, um Hingabe und Leidenschaft, um Wünsche, Ängste und Tabus.
Die Wissenschaft versteht die neurochemischen Vorgänge, die mit sexuellen Empfindungen und Handlungen zu tun haben, heute immer besser. So weiß man zum Beispiel, dass das Hormon Testosteron die Lust auf Sex stimuliert, und zwar bei Männern wie bei Frauen. Hirnforscher haben herausgefunden, welche neuronalen Netzwerke beim Orgasmus aktiviert werden. Oder was im Gehirn passiert, wenn Männer Sexvideos gucken. Aber was sagt uns das über Sex? Was verrät der Testosteronspiegel über Begehren? Was erzählen die bunten Flecken auf einem Hirnscan von sexueller Hingabe und Lust? Sex lässt sich nicht auf einen körperlichen Vorgang reduzieren. Im Bett läuft etwas ab zwischen Personen. Das gilt sogar für die Selbstbefriedigung: Auch wer nur masturbiert, stellt sich in der Fantasie meist Sex mit einem Partner vor. Es geht um ein komplexes Zusammenspiel von Berührungen, Gesten, Empfindungen und Gefühlen, das sich schwer in Worte fassen lässt. Die Aufmerksamkeit ist gespannt. Man berührt und erkundet den anderen. Wie sich sein Körper anfühlt, wie seine Haut riecht oder schmeckt. Was den anderen erregt und was nicht. Sex löst starke, oft unkontrollierbare Emotionen aus. Beim Sex stöhnen, hecheln, schreien, jammern, kichern oder seufzen wir. Es geht um Vertrauen und Verletzlichkeit, um Hingabe und Leidenschaft, um Wünsche, Ängste und Tabus.
Sex hat offenbar eine expressive Komponente. Er sagt etwas – und zwar zu einer anderen Person. Dabei geht es nicht nur um Lust und Befriedigung. Wenn Sex kein anderes Ziel hätte als den Orgasmus, dann könnte man ja auch nur masturbieren, um sein Ziel zu erreichen. Der amerikanische Philosoph Robert Solomon (1942–2007) hält Sex für eine Körpersprache, die Gefühle und Haltungen ausdrücken kann, wie etwa Zärtlichkeit, Vertrauen, Scham oder Anerkennung. So betrachtet ist Sex also eine komplexe, kunstvolle Form der Kommunikation, die man erst einmal erlernen muss. Das schreit nach sexuellem Sprachunterricht, nach fachkundiger Unterweisung in der Liebeskunst. Masturbation ist dann eine Art Selbstgespräch.
Einst verachteten die Philosophen sexuelles Begehren als vulgäre Fleischeslust. Heute neigen sie ironischerweise dazu, den Sex zu intellektualisieren. Den Geschlechtsakt verklären sie gern zu einem höheren Bewusstseinsakt – zu einer Art Verkörperung, über die wir mit einer anderen Person kommunizieren. Sexuelles Begehren sei kein Automatismus, sondern Intentionalität, meinte der französische Philosoph Maurice Merleau-Ponty (1908 –1961). Dabei begehren wir nicht bloß einen Körper, sondern den von »Bewusstsein beseelten Leib«, das »natürliche Ich« des anderen. Jean-Paul Sartre (1905 –1980), bekannt für seine zahllosen Affären, verstand Sex als Fleischwerdung. Nur indem wir uns selbst im Sex verkörpern, können wir uns nach Sartre das Fleisch des anderen aneignen. Sex ist Kommunion der Begierde. Allerdings fragt sich, wie man das verstehen soll. Sex muss nicht bedeuten, in der körperlichen Hingabe völlig aufzugehen. Man kann beim Sex ja auch an ganz andere Dinge denken – und sogar an andere Menschen. Sartre tat das wohl auch gelegentlich.
Sex kann auch spontan und heftig, ja besinnungslos sein.
Nicht immer erfordert Sex bewusstes Denken. Sex kann auch spontan und heftig, ja besinnungslos sein. Sicherlich kann Sex Liebe oder Zärtlichkeit ausdrücken. Aber das heißt nicht, dass Sex primär ein Kommunikationsmittel ist. Es gibt auch eine rein physische, triebhafte Komponente, die uns spüren lässt, dass wir körperliche Wesen sind. Sex kann berauschend, ja mindblowing sein, aber auch öde und leer. Sex kann uns überwältigen. Aber es kann auch mitten im Akt vorbei sein. Oft sprechen wir von gutem oder schlechtem Sex. Aber was meinen wir eigentlich damit? Guter Sex hat offenbar eine qualitative und eine moralisch-ethische Komponente. Bei der einen geht es um die Qualität des Erlebens, bei der anderen darum, wie man den Partner (und sich selbst) beim Sex behandeln soll. Guten Sex verbinden wir meist mit Lust, also mit einer intensiven, angenehmen Erfahrung. Manche glauben sogar, dass Lust der einzige Ma stab ist, an dem sich die Qualität von Sex messen lässt. Aber ganz befriedigend ist dieses Kriterium nicht. Sex kann auch verbunden sein mit Spannungszuständen, Anstrengungen oder sogar Schmerzen. Sex ohne sinnliche Empfindungen, ohne Berührung hätte keine Qualität. Sicher kann es angenehm oder erregend sein, einen nackten K rper zu betrachten. Aber es wäre traurig, müssten wir uns aufs Betrachten beschränken. Ohne Leidenschaft hingegen hätte Sex für uns keine besondere Bedeutung. Es wäre ein angenehmer Zeitvertreib, ein sinnliches Vergnügen, aber nicht mehr. Guter Sex braucht also Sinnlichkeit ebenso wie Leidenschaft. Aber es geht auch darum, was der Sex bei uns bewirkt – ob er uns befriedigt und wie sehr wir ihn genießen. Genuss und Befriedigung sind nicht dasselbe. Unter Genuss verstehen wir einfach ein Wohlbehagen bei etwas, das auf uns einwirkt. Genie en kann man einen Abend mit Freunden, ein gutes Konzert oder die Lektüre eines Buchs. Um etwas genießen zu können, muss man keinen Wunsch oder ein Bedürfnis haben. Befriedigung hingegen setzt ein Bedürfnis voraus. Befriedigung empfinden wir, wenn wir etwas gegessen haben und unser Hunger gestillt ist.
Was ist moralisch richtiger Sex?
Ein Orgasmus verschafft uns sicher Befriedigung im Sinne eines Spannungsabbaus. Das heißt aber noch nicht, dass wir den Sex auch genießen. Umgekehrt kann man Sex durchaus genießen, auch wenn man selbst nicht zum Höhepunkt kommt. Und ein besonderer Genuss kann es sogar sein, den Partner zu befriedigen. Aber ohne jegliche sexuelle Befriedigung können wir schwerlich guten Sex haben. Genuss allein reicht offenbar nicht. Mit jemandem zu schlafen, ist etwas anderes, als ein Klavierkonzert zu genießen. Man kann das kaum bezwingbare Verlangen verspüren, mit jemandem ins Bett zu gehen, aber kaum ein vergleichbares Verlangen, die Mondscheinsonate zu hören. Sex dient nicht nur zu Fortpflanzung und Lustgewinn, sondern auch der Verbindung mit anderen Menschen. Das haben die Philosophen von Platon bis Kant stets übersehen.
Nach Kant ist Sex in sich moralisch falsch, weil er eine Person zur Sache macht, zum Objekt seines Appetits, statt sich auf den ganzen Menschen zu richten. Sex führe zu einer Erniedrigung des Menschen, ja zu dessen Gleichsetzung mit der Tierheit. Nach Kants kategorischem Imperativ dürfen wir eine Person nämlich niemals nur als Mittel zu einem Zweck gebrauchen. Nur auf dem Institut der Ehe gründe sich das Recht, über die ganze Person zu disponieren – und damit auch das Recht auf Sex. Viele Philosophen glauben allerdings, dass Kant bei seinem Sex-Verbot ein Denkfehler unterlaufen ist. Natürlich kann Sex Menschen erniedrigen, man denke an bestimmte Praktiken des käuflichen Sex. Aber das gilt nicht für jede Form des Sex. Sicher gebraucht man einen Sexpartner auch als Mittel der Befriedigung. Aber das heißt noch lange nicht, dass man ihn nur als Mittel gebraucht. Sex an sich ist daher keine moralische Kategorie. Eine sexuelle Handlung ist nicht deswegen moralisch richtig oder falsch, weil sie eine sexuelle Handlung ist. Allerdings bringt uns Sex in der Regel mit anderen Menschen zusammen. Durch Sex können wir andere schädigen und demütigen, täuschen oder instrumentalisieren.
Guter Sex kann befriedigen und Glücksgefühle erzeugen, er kann Anerkennung geben, Vertrauen schaffen oder das Selbstwertgefühl stärken. Insofern hat Sex ein moralisches Potenzial, auch wenn er nicht in sich moralisch wertvoll ist, meint der amerikanische Philosoph Irving Singer. Das wirft allerdings die Frage auf: Was ist moralisch richtiger Sex? Und gibt es so etwas wie gerechten Sex?
Zu den Besonderheiten des Sex gehört es, dass er unsere moralische und sonstige Vernunft regelmäßig durchkreuzt.
Sicher gelten die Regeln der praktischen Ethik auch für sexuelle Handlungen. Auch beim Sex gilt das Prinzip,
niemandem zu schaden. Auch beim Sex müssen wir den anderen als Person respektieren. Und ein Utilitarist müsste eigentlich versuchen, den Nutzen für alle Beteiligten zu maximieren. Die Horizontale ist auch ein Kampfplatz der Moral. Es ist schwer einzusehen, warum wir moralische Prinzipien im normalen Lebensalltag respektieren sollten – und nicht auch
im Bett. Schließlich geht es auch beim Sex um wechselseitige Ansprüche, um Autonomie und um Gerechtigkeit. Wenn Lüge und Täuschung im normalen Leben moralisch falsch sind, dann muss das auch fürs Sexuelle gelten. Das Vortäuschen eines Orgasmus zum Beispiel widerspricht dann womöglich dem kategorischen Imperativ. Als rationale Wesen können wir streng genommen nicht wollen, dass alle ihren Orgasmus vortäuschen, denn dann wäre die Institution des Orgasmus sinnlos. Ein Utilitarist hingegen könnte die Täuschungshandlung für völlig in Ordnung halten, wenn der vorgetäuschte Orgasmus wenigstens dem anderen einen Lustgewinn bringt. Gerechtigkeit beim Sex kann sicher nicht Gleichheit bedeuten. Der eine hat diese Vorliebe, der andere jene. Sicher ist es guter Sex, wenn möglichst beide auf ihre Kosten kommen. Aber das kann eben auch heißen, dass der eine zum Höhepunkt kommt, während der andere nur genießt. Sicher ist es weniger guter Sex, wenn sich immer nur der eine befriedigen lässt und der andere unbefriedigt bleibt. So gesehen müssten beide Partner einander zumindest minimale sexuelle Verwirklichungschancen einräumen, im Sinne des Gerechtigkeitstheoretikers Amartya Sen. Und man kann die Fragen noch weitertreiben: Gibt es beim Sex so etwas wie ein Recht auf Orgasmus? Und hat man einen Anspruch auf Befriedigung, wenn der andere schon gekommen ist? Beim Sex betonen wir oft das Konsensprinzip. Erlaubt ist alles, womit alle Beteiligten einverstanden sind. Aber das erfordert nicht immer volle Autonomie. Sicher schränkt es meine Autonomie ein, wenn ich mich ans Bett fesseln lasse, um mich der Fremdbestimmung durch den anderen auszuliefern: Mach mit mir, was du willst. Zwar verliere ich die Kontrolle über die Situation, aber trotzdem bin ich dafür verantwortlich, weil ich sie selbst herbeigeführt habe. Das heißt allerdings nicht, dass der Partner tatsächlich alles tun kann, was er will. Zu den Besonderheiten des Sex gehört es, dass er unsere moralische und sonstige Vernunft regelmäßig durchkreuzt. Manchmal geben wir uns einfach unserer animalischen, triebhaften Seite hin, ohne über Moral auch nur nachzudenken. Sex kann auch mal egoistisch und gierig sein. Deswegen ist es noch nicht zwangsläufig schlechter Sex. Guter Sex heißt auch, sich dem anderen hinzugeben. Das kann man nur, wenn man vertraut. Vielleicht begreift man guten Sex im moralischen Sinn am besten als eine Praxis des Vertrauens. Bei gutem Sex muss ich nicht ständig überlegen, ob der Partner meine Verletzlichkeit ausnutzen wird, auch wenn ich ans Bett gefesselt bin. Ich kann einfach darauf vertrauen, dass er es nicht tun wird. Insofern reduziert Vertrauen – im Sinne von Niklas Luhmann (1927–1998) – auch die Komplexität des Sex.
Vielleicht begreift man guten Sex im moralischen Sinn am besten als eine Praxis des Vertrauens.
Liebe kann den Sex sicher verbessern, im qualitativen ebenso wie im moralischen Sinn. Sex zwischen Menschen, die einander lieben und vertrauen, wird oft als schöner erlebt als ein One-Night-Stand zwischen Fremden. Zugleich kann Sex aber auch ein gemeinsames Ritual sein, eben eine Praxis des Vertrauens, die Liebe zwischen zwei Menschen zum Ausdruck bringt und bekräftigt. Guter Sex kann der Liebe auch eine besondere Qualität verleihen. Er kann versöhnlich wirken und sogar helfen, schlechte Beziehungen zu retten. Allerdings gilt auch das Gegenteil: Schlechter Sex kann selbst die beste Liebesbeziehung auf die Dauer ruinieren.
Sexuelles Begehren und Liebe sind sicher nicht dasselbe. Weder drückt sich Liebe nur in Sex aus, noch muss Sex immer Liebe ausdrücken. Das klingt zwar heute für viele fast banal. Aber es ist nicht so klar, wie es vielleicht scheint. Zwischen Sex und Liebe besteht ein Zusammenhang. Liebe löst oft sexuelles Verlangen aus. Und Sex wiederum kann dazu führen, dass man sich verliebt. Wir überschätzen den Wert des Sex, wenn wir ihn mit dem Wert der Liebe verwechseln. Das hei t aber nicht, dass Sex einfach nur Sex ist. Sex kann viele Gefühle, Haltungen oder Stimmungen ausdrücken. Er kann Ausdruck von Zuneigung und Vertrauen sein, von Egoismus und Altruismus, aber auch von Langeweile und Mitleid, Macht oder gar Hass.
Von Liebesbeziehungen verlangen wir in der Regel immer noch sexuelle Exklusivität. Der Alleinanspruch wird oft damit begründet, Sex sei Ausdruck von Liebe und Intimität. Und Sex mit einem anderen zu haben, das heißt aus dieser Sicht, körperliche Intimität, die nur dem Partner zusteht, mit einer anderen Person zu teilen. Gegen diese Sicht gibt es im Prinzip zwei mögliche Argumentationsstrategien: Entweder man lockert die Verbindung zwischen Liebe und Sex – oder jene zwischen Liebe und Exklusivität. Die erste Strategie läuft hinaus auf Promiskuität, also unverbindlichen Sex mit mehreren Partnern, die zweite auf Polyamorie, also die Praxis, gleichzeitige Liebesbeziehungen – nicht nur in sexueller, sondern auch in emotionaler Hinsicht – mit mehr als einem Partner zu führen. Wenn Sex nicht zwingend Ausdruck von Liebe ist, dan ist nicht ganz einzusehen, warum er auf einen Liebespartner beschränkt sein soll. Der amerikanische Philosoph Paul Gregory etwa vertritt die These, dass durch das Festhalten am Alleinanspruch sexueller Bindungen andere Beziehungen blockiert werden. Nehmen wir etwa eine sexuelle Beziehung, in der die Partner nicht zusammenleben und auch sonst nicht allzu viel Zeit miteinander verbringen. Vielleicht spielt die Beziehung gar keine zentrale Rolle für ihr Leben.
Was eine solche Beziehung zu etwas Besonderem macht und von anderen Freundschaften unterscheidet, so argumentiert Gregory, ist im Wesentlichen die Tatsache, dass es die einzige Beziehung mit einer sexuellen Dimension ist. Aber wenn Sex Ausdruck einer engen Freundschaft sein soll, dann gibt es keinen Grund, warum nicht auch andere Freundschaften eine sexuelle Komponente haben sollten. Die geltenden Normen behindern das freie Spiel der Partnersuche. Alleinanspruch und Eifersucht führen nämlich dazu, dass es einem Einzelnen unm glich ist, sich anderen Menschen offen zuzuwenden, weil es immer so aussehen könnte, als würde er seinen Partner verraten. In ihrem Buch The Ethical Slut (deutsch: Die ethische Schlampe) verteidigen die US-Autorinnen Dossie Easton und Janet Hardy explizit einen sexuell freizügigen Lebensstil. Als stolze Schlampen gehen sie davon aus, dass Sex eine grundsätzlich positive Kraft sei, die das Potenzial habe, Bindungen zwischen den Menschen zu verstärken und ihr Leben zu verbessern. Sex sei eben pure Lust, ein Zweck in sich selbst. Warum also nicht m glichst viele Menschen mit Sex beglücken, so wie Philanthropen ihr Vermögen spenden?
Wenn man aber mehrere Sexpartner über die Zeit hinweg billigt, dann kann man sich mit Recht fragen, warum man nicht auch mehrere simultane Sexpartner akzeptieren soll.
Sexuelle Exklusivität bedeutet Einschränkungen, sagen die Polyamoristen. Schließlich muss man auf Sex mit anderen verzichten. Monogamie bedeutet selbst im Optimalfall, viel Erfahrungsreichtum und Entwicklungspotenzial zu verschenken, schreibt der Autor Oliver Schott in seiner Kampfschrift für Polyamorie (Lob der offenen Beziehung). Leidenschaftlicher Sex gehe in einer langjährigen Beziehung oft verloren. Und nicht immer harmonierten Menschen, die sich innig lieben, in sexueller Hinsicht optimal. Das monogame Modell neigt zudem zu einer gewissen Inkonsistenz. Einerseits geht man von sexueller Exklusivität während einer Beziehung aus. Zugleich akzeptiert man aber, dass der Liebespartner vor der Beziehung schon andere Sexpartner hatte. Wenn man aber mehrere Sexpartner über die Zeit hinweg billigt, dann kann man sich mit Recht fragen, warum man nicht auch mehrere simultane Sexpartner akzeptieren soll. Weder die Polyamoristen noch die »ethischen Schlampen« befürworten allerdings völlige Freizügigkeit. Vielmehr fordern sie strenge moralische Standards wie etwa ein Konsensprinzip, nach dem alle beteiligten Personen mit allem einverstanden sein müssen, und die Verbindlichkeit von Safer Sex. Jegliche Lügen werden abgelehnt. Die Polyamorie- Autoren Imre Hofmann und Dominique Zimmermann schlagen in ihrem Buch sogar eine universelle Beziehungsethik vor. Tatsächlich ist das monogame Modell gar nicht so leicht zu verteidigen. Offenbar gibt es keine prinzipiellen Gründe, die Sex mit mehreren Personen ausschließen, solange niemand betrogen wird oder sonstwie zu Schaden kommt. Wenn Sex kein privilegiertes Ausdrucksmittel von Liebe ist, dann spricht auf den ersten Blick erst einmal nichts dagegen, sexuelle Beziehungen auch zu Menschen zu haben, die man nicht liebt – und dies sogar neben einer wirklichen Liebesbeziehung, sofern alle Beteiligten damit einverstanden sind. Allerdings fragt sich, ob solche Modelle tatsächlich gelebt werden können.
Kaum zufällig sind Bücher über Polyamorie voll mit Regeln für den richtigen Umgang mit Eifersucht.
Jede offene Beziehungsform wird letztlich bedroht durch Eifersucht. Zwar könnte man Eifersucht einen moralisch fragwürdigen Besitzanspruch unterstellen. Doch Eifersucht ist mehr als Angst vor Verlust. Sie hat auch die Funktion, einen bevorzugten Status zu verteidigen, der einer Bedrohung ausgesetzt ist – und damit das eigene Selbstwertgefühl. Es ist nicht leicht einzusehen, warum diese Bedrohung in offenen Beziehungen geringer sein soll. Und falls Sex tatsächlich etwas ausdrückt, wenn auch nicht notwendigerweise Liebe, dann ist sexuelle Eifersucht nicht ganz unberechtigt. Genau das macht sexuelle Beziehungen mit mehreren Partnern so prekär. Der Grund liegt nicht in moralischen Gesetzen, sondern in der Schwierigkeit, andere Menschen nicht zu verletzen. Kaum zufällig sind Bücher über Polyamorie voll mit Regeln für den richtigen Umgang mit Eifersucht. Was guter Sex ist, hängt immer auch davon ab, was wir damit ausdrücken, welche Bedeutung wir ihm also geben. Das erfordert Sorgfalt im Umgang mit sexuellen Beziehungen. Das Problem der Eifersucht zeigt: Man kann schwerlich einfach nur Sex haben. Sex setzt uns immer in eine Beziehung zu anderen, ob wir das wollen oder nicht. Diese Beziehung muss zwar nicht auf Liebe gründen. Es kann in Ordnung sein, Sex ohne Liebe zu haben, sofern man jemandem (und sich selbst) damit etwas Gutes tut. Aber auch »reiner Sex« ist nur so gut wie das, was wir mit ihm machen.