Die Demokratie ist die am wenigsten schlechte Staatsform. Aber sie ist kein Wert an sich. Was bedeutet das für die Zukunft Europas?
Text: Tobias Hürter und Thomas Vašek
Am 26. September ist wieder Demokratietag in Deutschland, wie alle vier Jahre. Die Bundesbürger – oder die meisten von ihnen – machen ihre zwei Kreuzchen für die Abgeordneten des Bundestags. Es geht um Parteiprogramme, Finanzen und Familien und natürlich um Personen, allen voran um Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Danach ist, wenn alles gutgeht, wieder vier Jahre Ruhe. Um eines aber geht es zu wenig in diesen Monaten – um die Frage: Was tun wir da eigentlich? Was für eine Handlung ist dieses Kreuzchenmachen, in welchen Strukturen findet es statt, und ginge es vielleicht auch besser? Kurzum: Es geht zu wenig um das Wesen dessen, was wir »Demokratie« nennen, und um das Unwesen.
Jeder kennt die Demokratie, aber nicht jeder versteht sie. Sie ist Stoff für dröge Sonntagsreden, Heiligtum vieler Staatsverfassungen, Vorwand für Kriege und Gewalteinsätze. Aber wovon genau spricht man, wenn man »Demokratie« sagt? Da herrscht eine verwirrende Mehrdeutigkeit. Manchmal scheint das Wort ein politisches Ideal zu benennen, manchmal eine Staatsform, manchmal eine Regierungstechnik. Es hat verschiedene Bedeutungen in verschiedenen Kulturen und dient in seinen Abwandlungen verschiedensten politischen Anschauungen. Auch Diktatoren nennen sich selbst gern demokratisch, ebenso wie Faschisten, Anarchisten und Rassisten. »Die Demokratie ist jedermanns Geliebte und erhält ihren Zauber auch dann, wenn ein Liebhaber sieht, dass er ihre Gunst mit vielen anderen teilen muss«, sagte der englische Politikwissenschaftler Bernard Crick (1929 –2008). Doch auf Dauer geht das nicht gut mit den vielen Liebhabern. Der Begriff der Demokratie ist weich wie Gummi geworden. Es ist Zeit, ihn zu schärfen.
Das deutsche Wort »Demokratie« ist dem Lateinischen entlehnt, dessen democratia wiederum auf das Griechische zurückgeht: demos bedeutet Volk, kratein heißt herrschen. Herrschaft des Volkes also. Die Stadt Athen war die erste Gesellschaft der Geschichte, die sich demokratisch nannte. Aber so richtig stolz waren die Athener nicht auf ihre Erfindung. Viele antike Autoren verstanden die Demokratie als Diktatur des Pöbels – eine selbstsüchtige, unstete, ahnungslose Meute. Platon verachtete die Demokratie als Herrschaft der Meinung über die Weisheit: doxa statt philosophia.
Die Athener Urdemokratie war eher aus der Not geboren als aus Überzeugung. Im 6. Jahrhundert vor Christus reagierten die Athener auf die wachsenden Spannungen in ihrer Gesellschaft mit einem Schritt, der heute undenkbar wäre: Sie ernannten einen Alleinherrscher, um die Gesellschaft wieder ins Lot zu bringen. Und Solon machte seinen Job gut. Er reformierte Wirtschaft und Staat – vor allem öffnete er die Volksversammlung ekklesia, die bis dahin ausschließlich aus Landbesitzern bestanden hatte, auch für Kaufleute. Dieser Öffnungsprozess ging die nächsten Jahrzehnte weiter und mündete nach dem Sieg Athens über die Perser im sogenannten goldenen Zeitalter unter Perikles, dem großen General und Redner. Er führte das Berufsbeamtentum ein und verhalf der Volksversammlung zu höchster Macht. Jeder erwachsene Mann, der sich nicht durch ein schwereres Vergehen disqualifiziert hatte, durfte an ihr teilnehmen. Sie war die einzige gesetzgebende Körperschaft, kontrollierte die Verwaltung und die Justiz. Einmal im Monat traten 6000 Bürger zur ekklesia zusammen. Jeder von ihnen konnte das Wort ergreifen und Beschlussvorschläge machen.
Heutige Demokratien sind eher Republiken im römischen Sinn
Nach unseren heutigen Maßstäben muss eine Demokratie egalitär sein: Alle dürfen mitmachen. Doch die attische Demokratie war eher elitär als egalitär, sie schloss einen Großteil der 300 000 Athener aus: Frauen, Jugendliche, Fremde (»Barbaren«) und einheimische Sklaven. Umgekehrt würde Aristoteles sich wohl wundern, wenn er in Artikel 20 des deutschen Grundgesetzes lesen würde: »Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.« Für ihn wäre die Bundesrepublik keine Herrschaft aller, also keine Demokratie, sondern eine Herrschaft weniger, eine Oligarchie – auch wenn diese wenigen vom Volk gewählt sind.
Die Athener haben den Begriff der Demokratie geprägt. Aber ein historisches Vorbild waren sie nicht. Sie selbst waren überzeugt, dass eine Demokratie nur in kleinen Stadtstaaten funktioniert, in denen jeder jeden kennt. Aristoteles forderte sogar, eine Stadt solle nicht größer sein, als dass die Stimme des städtischen Ausrufers von einem Ende zum anderen reiche, und nicht größer, als dass jeder Bürger den Charakter jedes anderen Bürgers kennen könne.
So sind viele heutige Staaten, die sich »demokratisch« nennen, keine Demokratien im attischen Sinn, sondern eher Republiken im römischen Sinn. Die römische Republik begann im Jahr 510 vor Christus, nachdem die Römer ihren König gestürzt und durch gewählte Beamte ersetzt hatten. Nie mehr sollte ein einzelner Mann die höchste Staatsgewalt ausüben dürfen. Eine direkte Demokratie à la Athen kam für die Römer nicht infrage. Ihr Reich erstreckte sich vom Atlantik bis zum Kaspischen Meer. Allein Rom hatte eine Million Einwohner. Die Römer entwickelten ein kompliziertes System der repräsentativen Demokratie, in dem das Amt des Konsuls das höchste war. Es gab zwei davon, gewählt von Versammlungen namens Zenturiatskomitien, eigenartigen Mischformen zwischen Volksversammlungen und Heeresversammlungen. Sie leiteten die Sitzungen des Senats, der mächtigsten Institution des Reichs, und der Volksversammlungen, die die Richter wählten und über Gesetze abstimmten. »Der Senat schlägt Gesetze vor, das Volk entscheidet über sie, die Magistrate führen sie aus«, fasste der griechische Geschichtsschreiber Polybios (um 200 –120 v. Chr.) die römische Verfassung zusammen. Das politische Leben in Rom war durchzogen von unzähligen Intrigen, aber es gab auch einen großen Zusammenhalt zwischen Patriziern, Plebejern und der Armee, zusammengeschweißt durch viele Kriege mit äußeren Feinden.
Die römische Republik war Vorbild vieler späterer Staaten, etwa der französischen Republik nach der Revolution von 1789 und der amerikanischen Republik nach der Unabhängigkeit von Großbritannien. Nicht zufällig heißt eine Kammer des amerikanischen Kongresses Senat. Doch diesen Republiken liegt ein anderes Verständnis von Demokratie zugrunde, als es die Griechen hatten. Das Volk
muss nicht mehr selbst herrschen, es genügt, dass es der Herrschaft zustimmt. Kurzum: Demokratie ist ein Prinzip zur Legitimation von Herrschaft.
Viele Menschen antworten auf die Frage, wie sie Demokratie definieren würden, mit: »Die Mehrheit bestimmt.« Aber allein das Mehrheitsprinzip kann es nicht sein. Man stelle sich vor, es träten zwei neue Parteien zur Bundestagswahl an: zuerst eine Rechtshänderpartei, dann in Reaktion darauf eine Linkshänderpartei. Das Programm der Rechtshänderpartei zielt darauf, den Linkshändern die Lasten der Gesellschaft aufzubürden: Sie sollen den Müll entsorgen und eine Linkshändersondersteuer entrichten. Die Linkshänder wehren sich dagegen. Aber sie haben keine Chance. Sie sind 10:90 in der Minderheit. Und so fällt auch das Wahlergebnis aus. Fortan leben die Rechtshänder auf Kosten der Linkshänder.
Das Mehrheitsprinzip allein reicht nicht
Ist das gerecht? Nein, Diskussion überflüssig. Ist es demokratisch? Das ist schwieriger zu beantworten. Offenbar gehört mehr zu einer Demokratie als das Mehrheitsprinzip. Der amerikanische Philosoph Ronald Dworkin (1931 –2013) ging sogar so weit, politische Systeme, die ihre Entscheidungen ausschließlich nach dem Mehrheitsprinzip treffen, für nicht wirklich demokratisch zu erachten. Jede Art von Demokratie, »die in Fragen individueller Rechte die Unterwerfung unter wechselnde Mehrheiten erwartet, ist brutal und unangemessen, und viele andere Nationen mit starken demokratischen Traditionen weisen so etwas heute als Schwindel zurück«, schrieb er in seinem Buch »Freedom’s Law«. Sein Gegenmodell zur Mehrheitsdemokratie ist die Partnerschaftsdemokratie, in der die Bürger nicht nur ihre Stimmen abgeben, sondern auch die Ansichten und Stimmen der anderen Bürger beeinflussen. In einer partnerschaftlichen Demokratie wird nicht nur abgestimmt, sondern auch diskutiert und argumentiert. Auf diese Weise bestimmen alle Bürger mit, nicht nur die Anhänger der Mehrheitsmeinung. Der Wahlakt ist nur der letzte Schritt des demokratischen Prozesses.
Dworkin hat dafür argumentiert, dass Demokratie mehr ist als formale Teilnahme an demokratischen Prozeduren. Ein Mensch muss zu der Gemeinschaft gehören, um deren Demokratie es geht. Nur dann kann man von der Gemeinschaft erwarten, dass sie seine Belange ernst nimmt, und nur dann kann man von ihm erwarten, dass er die demokratischen Entscheidungen dieser Gemeinschaft akzeptiert, auch wenn er selbst anders entschieden hätte. Eine freie Gesellschaft, die zusammenhält, ist eine Voraussetzung für eine gesunde Demokratie. »Das Ideal der Demokratie setzt eine politische Gemeinschaft voraus«, schrieb Dworkin, »es kann nicht dazu benutzt werden, eine solche Gemeinschaft zu definieren.«
Worin bestehen die Voraussetzungen der Demokratie?
Seitens des Staates ist die Antwort klar: Er muss den Menschen ihre Freiheitsrechte garantieren, durch Gesetze und eine unabhängige Justiz. Das bedeutet, dass einige Gesetze, um diese Voraussetzung zu schaffen, noch über der Demokratie stehen müssen. Im Grundgesetz ist das gut erkennbar. Es ist zwiegespalten in Sachen Demokratie. »Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus«, steht in Artikel 20, Absatz 2. Einerseits. Andererseits setzt das Grundgesetz dem Willen des Volkes Grenzen. So erklärt es in seinem Artikel 19, Absatz 2: »In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.« In keinem Falle. Auch nicht, wenn das Volk einhellig für Antasten wäre. Bei den Grundrechten wird das Grundgesetz undemokratisch und platonistisch. Es setzt sie als unverrückbare Wahrheit, über die sich nicht diskutieren oder abstimmen lässt.
Und welche Voraussetzungen braucht Demokratie seitens der Bürger?
Wenn Demokratie ein Prinzip zur Legitimation von Herrschaft ist, dann müssen auch die Bürger dieses Prinzip akzeptieren. Es genügt nicht, dass die Deutschen am 26. September ihre Meinung auf den Stimmzetteln äußern. Sie müssen auch das Ergebnis akzeptieren – auch wenn es ihnen nicht passt. Ein guter Demokrat braucht einen Schuss Schizophrenie: »Ich missbillige, was du sagst, aber würde bis auf den Tod dein Recht verteidigen, es zu sagen.« Dieses berühmte Zitat von Voltaire (das er wohl nie gesagt hat, aber durchaus hätte sagen können) bringt diese Schizophrenie auf den Punkt. Ein Demokrat muss akzeptieren, was er bekämpft. Toleranz gegenüber Andersdenkenden gehört zum Wesen der Demokratie. Gleichzeitig aber gehört zum Wesen der Demokratie, dass diese Toleranz Grenzen hat, nämlich dort, wo die Bedingungen der Demokratie bedroht sind. Das Grundgesetz nennt diese Bedingungen »die freiheitlich demokratische Grundordnung«.
Ohne ein Mindestmaß an sozialem Zusammenhalt keine Demokratie. Ohne ein Minimum an Fairness und Solidarität funktioniert sie nicht.
Man kann den Begriff der Demokratie genauer fassen, indem man Demokratie als eine Form von Kooperation versteht: Am 26. September legitimieren die Wahlbürger gemeinsam den 20. Bundestag. Wie jede Kooperation setzt auch diese eine Beziehung zwischen den Kooperationspartnern voraus. Zwar müssen sie sich nicht von Angesicht zu Angesicht kennen wie einst in Athen – das ist in Staaten von heutiger Größe nicht mehr denkbar. Wir kennen viele unserer Mitmenschen gar nicht und auch die meisten Protagonisten unserer Demokratie nur noch aus den Medien. Doch der Anspruch, den Aristoteles und andere frühe Demokratiedenker stellten, ist nicht veraltet: Ohne ein Mindestmaß an sozialem Zusammenhalt keine Demokratie. Ohne ein Minimum an Fairness und Solidarität funktioniert sie nicht.
Wenn Bürger den Staat nur noch als Service-Dienstleister verstehen, schwindet eine wichtige Voraussetzung für Demokratie. Sich nehmen, was einem gefällt, und den Rest liegen lassen – so läuft es nicht. Wenn, wie das deutsche Grundgesetz erklärt, »alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht«, dann ist diese Macht mit Pflichten verbunden – vor allem mit der Pflicht, diese Gewalt auch auszuüben. Wenn zu viele Wahlberechtigte die Ausübung dieser Pflicht verweigern, zum Beispiel nicht wählen, wird es gefährlich für die Demokratie. Bei 30 Prozent Wahlbeteiligung am 26. September hätten der nächste Bundestag und die nächste Regierung ein Legitimationsproblem.
Was ist zuerst da, die Demokratie oder die Gemeinschaft – Henne oder Ei?
Demokratie setzt also ein gewisses Maß an Gemeinschaft voraus. Gleichzeitig schafft sie Gemeinschaft, wie jede Kooperation. Was ist zuerst da, die Demokratie oder die Gemeinschaft – Henne oder Ei? Das ist die Frage, die sich gerade auf europäischer Ebene stellt. Offenbar fehlt es an Gemeinschaft und an Demokratie. Der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas fordert daher die Einführung europaweiter demokratischer Strukturen, in der Hoffnung, dass die Gemeinschaft, die diese Demokratie braucht, um zu funktionieren, daraus entstehe. Womöglich stellt Habermas die Dinge auf den Kopf. Solange es kein europäisches Gemeinwohl gibt, mit dem die Europäer sich identifizieren, würde auch eine europäische Demokratie scheitern. Auch wenn es eine europäische Kultur gibt, folgt daraus nicht, dass auch eine europäische Demokratie möglich ist.
Warum sollte man sich eine europäische Demokratie wünschen? Worin besteht überhaupt der Wert der Demokratie? Ist sie ein universeller Wert? Frühe Verfechter der modernen Demokratie gaben oft pragmatische Gründe für ihre Position an: Niccolò Machiavelli (1469–1527) erklärte in seinen »Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio«, dass es einen Staat stärker mache, wenn er seine Bürger einbindet. Der englische Staatsmann Thomas Cromwell (1485–1540) empfahl dem Schreckenskönig Heinrich VIII., seiner Herrschaft eine gewisse Gesetzmäßigkeit zu geben, weil sie so »sicherer und ruhiger« werden würde. Aber allein die Stabilität macht die Demokratie noch nicht zu einem Wert. Auch schlechte Dinge können stabil sein.
Befördert Demokratie die Freiheit?
In den Augen mancher ihrer Verteidiger liegt der Segen der Demokratie auf der Hand. »In unabhängigen Staaten mit demokratischer Regierungsform und einigermaßen freier Presse gab es bisher keine substanzielle Hungersnot«, stellt der indische Ökonom Amartya Sen fest. Er wehrt sich daher gegen die Behauptung, bestimmte Gesellschaften seien ungeeignet für Demokratie. Demokratie ermögliche politische Teilnahme aller, sagt Sen, sie verschaffe auch Minderheiten eine Stimme und fördere soziale Lernprozesse. Für Sen ist die Frage nach den Voraussetzungen von Demokratie falsch gestellt, er fragt nach den Wirkungen von Demokratie.
Auf den ersten Blick könnte man tatsächlich denken, der Wert einer Demokratie liege darin, dass sie Freiheit und Gleichheit hervorbringt. In einer Diktatur liegt die politische Macht bei einer einzigen Person oder einer kleinen Gruppe. In der Demokratie hingegen hat prinzipiell jeder die gleiche politische Macht, schließlich kann ja jeder wählen. So gesehen befördert eine Demokratie, die an die Stelle einer Diktatur tritt, sicherlich die Freiheit. Aber ganz so klar ist die Sache nicht. Schließlich bestimmt die Mehrheit ja über die Minderheit – und schränkt damit deren Freiheit zwangsläufig ein. Der Angehörige einer Minderheit in einer reinen Mehrheitsdemokratie wird Sens Sicht der Demokratie als Allheilmittel also nicht unbedingt teilen.
Nach Platon sollten wir nicht der Mehrheit folgen, sondern denjenigen, die am besten wissen, was zu tun ist. Wir können nicht davon ausgehen, dass alle Menschen über ein gleich fundiertes Urteil verfügen. In der Demokratie aber zählt jede Meinung gleich viel. Daher kann sie Platon zufolge kein geeignetes Instrument sein, um zu bestimmen, was der Staat tun sollte. Wer die Demokratie rechtfertigen will, kommt an Platons Argument bis heute nicht vorbei.
Das Volk, so dachte Platon, ist zum Regieren schlicht zu dumm. Es wäre folglich reiner Zufall, wenn bei einer demokratischen Abstimmung eine »richtige« Entscheidung herauskäme, die auf wirklichem Wissen gründet. Nun ließe sich bestreiten, dass es in politischen Fragen überhaupt Wahrheiten gibt, die »gewusst« werden können. Jemand könnte etwa argumentieren, dass die Politik von Wertfragen handelt, in denen es eben keine unabhängigen Wahrheiten gibt, sondern nur verschiedene Meinungen. Dann allerdings fragt sich auch, welchen Wert die Demokratie selbst hat.
Unter »Wissen« verstehen wir Überzeugungen, die durch Tatsachen und gute Argumente gestützt sind. Wissen unterscheidet sich von subjektiver Meinung, Vorurteil oder Gefühl. Es setzt Information, Überlegung und Urteilsvermögen voraus. Um Platons Argument gegen die Demokratie zu widerlegen, muss man also zeigen, dass die demokratische Mehrheit über solches Wissen verfügt. Woher sollte dieses Wissen kommen, wenn nicht von den einzelnen Bürgern? Wenn die einzelnen Bürger nichts wissen, dann trifft sehr wahrscheinlich auch die Mehrheit unkluge Entscheidungen. Aus diesem Grund ist es nicht immer eine gute Idee, die Bürger über politische Entscheidungen direkt abstimmen zu lassen. Direkte Demokratie setzt Urteilsvermögen und Überlegung voraus, sonst führt sie letztlich zu einer Herrschaft des Mobs, die auf Vorurteilen und Emotionen gründet. Das ist einer der Gründe, warum »Schwarmintelligenz« nicht immer funktioniert. Unter bestimmten Umständen ist die Masse zwar tatsächlich klüger als das klügste Individuum. Aber das funktioniert nur dann, wenn die Einzelnen ein Mindestmaß an Urteilsvermögen haben. Eine ahnungslose, irrationale Masse läuft mit hoher Wahrscheinlichkeit in die falsche Richtung.
Öffentliche Meinungsbildung
Demokratie kann nicht nur darin bestehen, die Meinungen der Bürger aufzuaddieren. Sie braucht einen Prozess der öffentlichen Meinungsbildung. Dazu gehört, dass die Bürger ihre Meinungen zur Diskussion stellen, andere zu überzeugen versuchen – und sich gegebenenfalls überzeugen lassen. Nach dem Konzept der »deliberativen Demokratie« beruhen legitime demokratische Entscheidungen auf einem Prozess des »Beratschlagens«, in dem die Bürger ihre Präferenzen erst herausfinden. Deliberative Demokratie setzt allerdings voraus, dass sich alle Bürger gleichermaßen an diesem Prozess beteiligen können. Das erfordert aber mehr als gleiche politische Rechte. Die Bürger müssen sich mit ihren Vorstellungen aktiv in diese Diskussion einbringen. Das werden sie nur tun, wenn das Thema der Diskussion sie berührt.
Schon Jean-Jacques Rousseau (1712 –1778) glaubte, dass Demokratie ein Minimum sozialer Gleichheit erfordert. In seinem »Gesellschaftsvertrag« forderte er, dass »ferner kein Staatsbürger so reich sein darf, um sich einen andern kaufen zu können, noch so arm, um sich verkaufen zu müssen«. Ungleichheit bedroht den sozialen Zusammenhalt. Damit schwächt sie auch die Kooperation, schreibt der amerikanische Soziologe Richard Sennett in seinem Buch »Zusammenarbeit«: »In der alltäglichen Erfahrung wird aus ökonomischer Ungleichheit soziale Distanz. Die Elite entfernt sich von der Masse, Erwartungen und Kämpfe eines Lkw-Fahrers haben wenig mit denen eines Bankers gemeinsam.«
Diese soziale Distanz wächst auch innerhalb Europas. Jeder vierte Europäer unter 25 Jahren ist derzeit arbeitslos. In Griechenland und Spanien ist es jeder zweite, in Italien und Portugal jeder dritte. »Eine europaweite Bürgersolidarität kann sich nicht herausbilden, wenn sich zwischen den Mitgliedsstaaten, also an den nationalen Sollbruchstellen, soziale Ungleichheiten strukturell verstetigen«, schreibt Jürgen Habermas in seinem Essay »Zur Verfassung Europas«. Das ist zweifellos richtig. Aber zugleich sagt Habermas, dass jedes legitime demokratische Gemeinwesen das »Übertragungsmedium einer staats- oder überstaatsbürgerlichen Solidarität« braucht. Das führt zu einem schwer lösbaren Widerspruch. Womöglich setzt die supranationale Demokratie, die Habermas für Europa fordert, genau jene Solidarität voraus, die sie befördern soll.
Ist eine europäische Demokratie möglich?
Vor einigen Jahren unterzeichneten Habermas und andere prominente Intellektuelle ein »Manifest zur Neugründung Europas von unten«, in dem ein »Europäisches Freiwilligenjahr« für junge Europäer gefordert wird. »Es geht darum, die nationalen Demokratien europäisch zu demokratisieren und auf diese Weise Europa neu zu begründen«, heißt es in dem Manifest. »Nach dem Motto: Frage nicht, was Europa für dich tun kann, frage vielmehr, was du für Europa tun kannst.« Man wolle der europäischen Bürgergesellschaft eine Stimme geben und ein »Europa der tätigen Bürger« schaffen.
Wäre die Demokratie ein Wert an sich, dann wäre auch eine europäische Demokratie ohne Weiteres zu begrüßen. Aber Demokratie ist kein Wert an sich, sie ist ein Prinzip zur Verwirklichung von Werten. Sie braucht den richtigen Boden, um zu gedeihen. Wenn den Bürgern, die sie mit Leben füllen sollen, jedes Interesse an einem europäischen Gemeinwohl fehlt, kann eine europäische Demokratie dieses Gemeinwohl nicht fördern. Es braucht ein Minimum an Solidarität und dafür ein Minimum an gesellschaftlichem Zusammenhalt. Habermas und andere glauben, eine europäische Demokratie, angestoßen durch Formalitäten wie eine durch ein Referendum legitimierte europäische Verfassung, könne sich ihren Boden selbst bereiten. Dieser Glaube ist nicht mehr als eine Hoffnung.
Wie mühsam Demokratie ist, wenn ihr der Boden fehlt, zeigte sich in den Jahren nach der deutschen Einheit. Der neue und der alte Teil der Bundesrepublik waren zwar formal geeint, aber manchmal schien es, als existierten da zwei Demokratien nebeneinander her, die sich nur allmählich zusammenrauften. »Welche Probleme auch immer die deutsche Wiedervereinigung mit sich brachte«, sagte Ronald Dworkin kurz vor seinem Tod, »die Deutschen fühlten sich als Deutsche.« Wie lange wird es dauern, bis die Europäer sich als Europäer fühlen? Werden sie es überhaupt je? Zweifel sind berechtigt. Vielleicht wären auch Aristoteles welche gekommen. Europa erfüllt nicht seine Voraussetzungen für eine Demokratie. Es ist schwierig, von einem Ende des Kontinents zum anderen zu rufen, auch im Zeitalter der elektronischen Medien. Es liegt nicht nur an der Entfernung, es liegt an den unterschiedlichen Sprachen, Werten und Interessen. Das muss nicht heißen, dass eine europäische Demokratie unmöglich ist. Aber sie hat Voraussetzungen, die womöglich erst noch erfüllt werden müssen.
Auch auf nationaler Ebene ist es nicht selbstverständlich, dass die Voraussetzungen einer funktionierenden Demokratie erfüllt bleiben. Wenn sich die Gesellschaft so weit auseinanderentwickelt, dass sich große Teile der Bevölkerung nicht mehr für das Wohl anderer großer Teile interessieren, etwa Arme und Reiche, dann könnte auch aus der deutschen Demokratie ein bloßer Machtkampf der Interessen werden.
Manche Soziologen behaupten, dass viele Staaten, die sich demokratisch nennen, diese Bezeichnung bereits jetzt nicht mehr verdienen. Der Brite Colin Crouch spricht von Postdemokratie: einer Demokratie zum Schein, in der das Volk nicht bestimmt, sondern sich von Konzernen und Spindoktoren bestimmen lässt. Wenn Crouch damit recht hat, ist das ein Hinweis darauf, dass die Voraussetzungen für Demokratie erodieren. Dann ist das Demokratiedefizit nicht zu beheben, indem man die Bürger mehr mitreden lässt. Dann ist das Demokratiedefizit in Wirklichkeit ein tiefes Gemeinschaftsdefizit, das in wachsender Arbeitslosigkeit und sozialer Ungleichheit sichtbar wird. Das sind die eigentlich bedauerlichen Dinge.
Dieser Artikel erschien in HOHE LUFT 5/2013 und wurde in Hinblick auf die aktuelle Wahl im September 2021 aktualisiert.

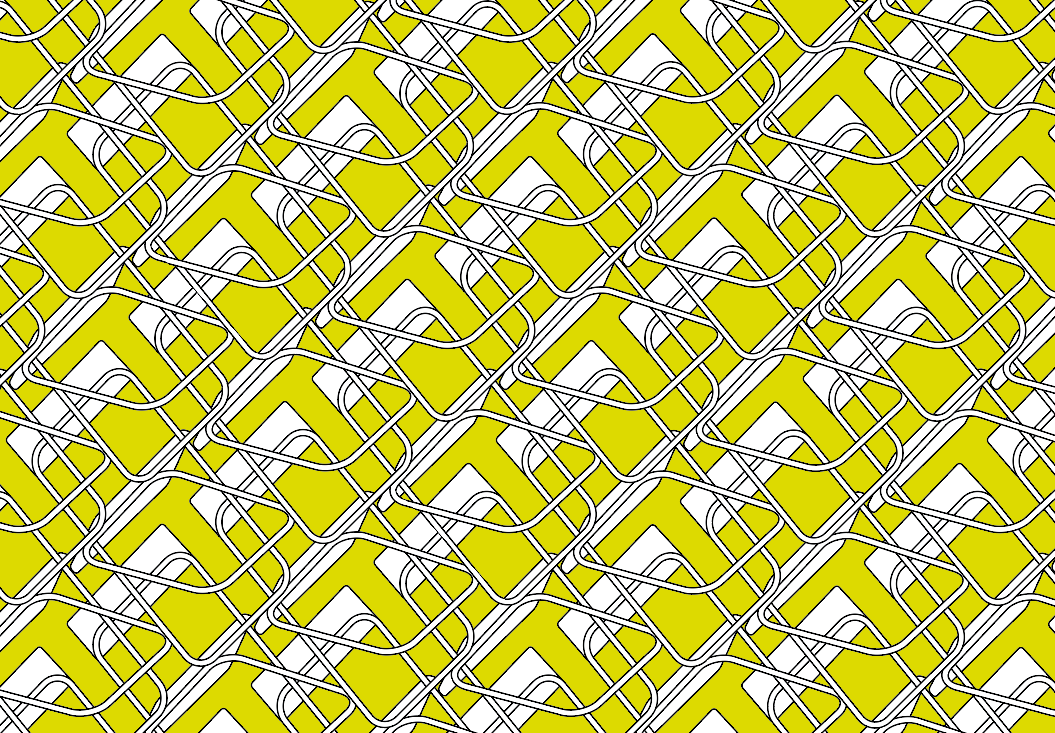
1 Kommentare