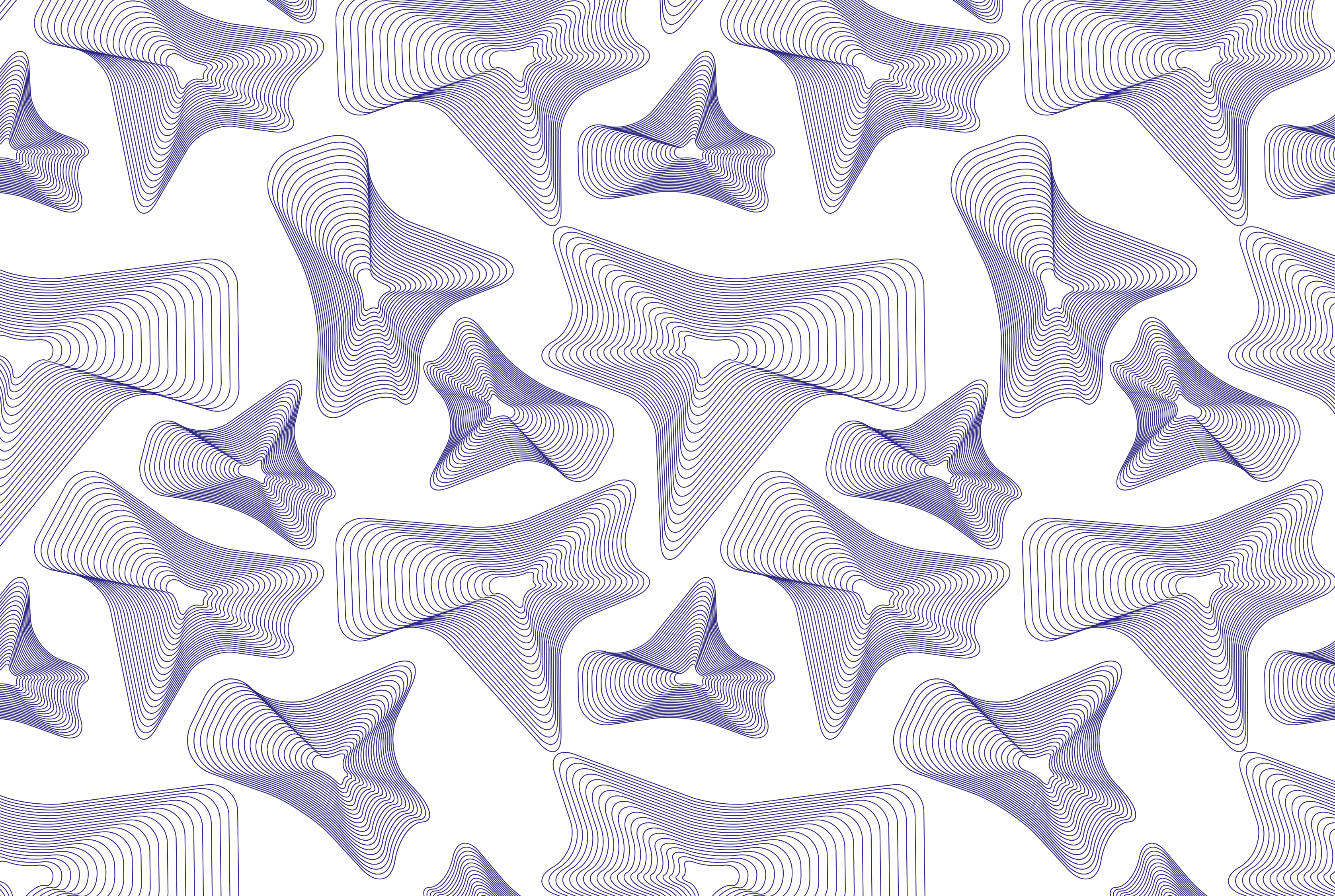Edith Stein war eine außergewöhnliche Person. In Zeiten, in denen Frauen die Karriere als Universitätsprofessorin noch verwehrt
war, ging sie ihren ganz eigenen Weg und unterwarf ihr Denken nur einem: dem Heiligen. Wer war sie?
Text: Rebekka Reinhard
Sommer 1916. Bei einer Großoffensive der Alliierten in Nordfrankreich sterben fast eine halbe Million deutsche Soldaten. Italien erklärt nach Österreich-Ungarn auch Deutschland den Krieg. Vielerorts herrscht Hunger. Zu dieser Zeit erlebt eine Jüdin in Freiburg ihren großen Moment: Edith Stein. Am 3. August wird sie als eine der ersten Frauen überhaupt zur Doktorin der Philosophie promoviert. Ihr Doktorvater, der große Edmund Husserl (1859–1938) höchstpersönlich, hat in sein Haus geladen, Husserls Tochter setzt der Jungwissenschaftlerin einen Kranz aus Efeu und Margeriten auf. Den Heimweg muss sie wegen drohender Bombenangriffe in totaler Finsternis antreten. Es ist das paradoxe Nebeneinander von Hell und Dunkel, das ihr Leben prägt; das sie motivieren wird, mit extremer Konsequenz nach dem Sinn menschlicher Existenz zu fahnden. In ihrem Denken, ihrem Glauben, in all ihren Lebensentscheidungen.
Wer war Edith Stein? Dem breiten Publikum ist sie nahezu unbekannt. Aktuelle populäre Titel wie Wolfram Eilenbergers »Zeit der Zauberer« (2018) über die deutsche Philosophie der 1920er-Jahre erwähnen ihren Namen in keiner Fußnote, und auch in den akademischen Publikationen spielt sie keine große Rolle. So erhalten Werk und Persönlichkeit der gläubigen Philosophin bis heute nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen.
Edith Stein wird am 12. Oktober 1891 in eine kinderreiche jüdische Familie im schlesischen Breslau geboren. Der Vater, ein Holzhändler, stirbt jung. Auguste Stein (»Was man will, das kann man!«) übernimmt das Geschäft und betreibt es erfolgreicher denn je. Ihre Jüngste, die »kluge Edith«, wie ihre Geschwister sie nennen, sticht unter den anderen durch ausgeprägten Eigenwillen heraus. Früh neigt sie dazu, sich in ihre »innere Welt« zurückzuziehen. Sie träumt davon, »zu etwas Großem bestimmt« zu sein, heißt es in ihrer Autobiografie. Was es ist, weiß Edith noch nicht. Sie weiß nur: Wann immer ihr etwas »wahr« erscheint, ein Gedanke, eine Situation, muss sie diesem Wahren auf den Grund gehen.
Auguste Stein tut, was in ihrer Macht steht, um die Entwicklung ihrer Kinder zu fördern. Bildung, Reisen und eine liberale politische Haltung gelten ihr so viel wie die jüdischen Feste; zu jedem Sabbat backt sie eigenhändig die traditionellen, zu Zöpfen geflochtenen Weißbrote. Doch wie viel wahrer Glaube steckt hinter solchen Riten? Wenig, vermutet Edith. Mit 15 ist sie überzeugte Atheistin. Sie liebt das Theater und die Oper, liest Grillparzer, Hebbel, Goethe, Shakespeare. Durch die Lektüre des Kantianers Friedrich Schiller (1759–1805) entdeckt sie ihr Interesse an der Philosophie.
Da Frauen ihrer Zeit eine Universitätslaufbahn – und damit eine Habilitation – verwehrt ist, beginnt sie nach dem Abitur ein Lehramtsstudium in Germanistik und Geschichte. Philosophie wählt sie als Nebenfach. In ihrem grenzenlosen Wissensdrang schreibt sie sich zusätzlich in Indogermanisch, Psychologie, Englische Verfassungsgeschichte sowie andere Fächer ein und engagiert sich darüber hinaus auch im studentischen »Frauenverein«.
Mit der »idiotischen« Masse der Studenten hat sie wenig am Hut. Dafür legt sie großen Wert auf die Gemeinschaft mit Menschen, mit denen sie sich geistig austauschen kann – wie ihre Studienfreunde und Lehrer in Göttingen, die Philosophen Theodor Lipps (1851–1914), Roman Ingarden (1893–1970), Hedwig Conrad-Martius (1888–1966) oder Adolf Reinach (1883–1917), zu denen sie innige Beziehungen pflegt. Ediths intellektuelles Selbstbewusstsein ist groß. Als ein Kommilitone sie im Herbst 1912 auf Edmund Husserls »Logische Untersuchungen« (1900/01) stößt, sieht sie darin den Beginn ihres eigenen Denkwegs angelegt – die Erforschung der Beziehung des einzelnen Ichs zu anderen; des Mensch- und Personseins überhaupt, Körper, Seele, Geist.
Edith Stein findet in Husserls Thesen eine Lücke
Husserl ist der Philosoph der Stunde, alle in seinem Umfeld nennen ihn den »Meister«. Auf der Suche nach einer endgültigen Fundierung der Philosophie rückt die von Husserl begründete Phänomenologie die Methodik in den Vordergrund. Husserl will »zu den Sachen selbst!«, zum »Phänomen« in seiner unmittelbaren, unzweifelhaften Gegebenheit. Allerdings gibt es seiner Meinung nach kein von der Welt abgetrenntes Bewusstsein: Dieses ist stets gerichtet, stets Bewusstsein von etwas. Innen- und Außenwelt stehen immer schon in Beziehung zueinander. Möchte man etwa das Phänomen Tisch fassen, hat man unter Ausschaltung (epoché) sämtlicher Urteile und sonstiger angenommener Voraussetzungen, Hypothesen und Erfahrungen durch eine Reihe von »Reduktionen« zum »phänomenologischen Residuum« oder »Wesen« (eidos) der Sache zu gelangen.
In Husserls These, dass die »objektive Außenwelt nur intersubjektiv erfahren werden kann«, macht Edith eine »Lücke« aus: das Zwischenmenschliche. Sie bittet den Meister um die Erlaubnis, bei ihm über das »Einfühlungsproblem« promovieren zu dürfen, denn was Einfühlung sei, hat er noch nicht erklärt. Während Husserl sich noch geschmeichelt fühlt, dass die junge Frau so gründlich mit seinen Schriften vertraut ist, hat diese daraus längst eigene Fragestellungen entwickelt: Wie erfahren wir fremdes Bewusstsein, wie bekommen wir Zugang in die Innenwelt des anderen? Eben durch Einfühlung, ist Ediths Antwort. Ihr erscheint der andere Mensch nicht nur als empfindender Körper, sondern auch als wahrnehmendes Subjekt, welches von außen bewegt wird, sich aber auch von innen heraus selbst bewegt.
Das Individuum ist Teil einer körperlichen Welt ebenso wie der Welt geistiger Werte: »Wir können das psychophysische Individuum als Realisation der geistigen Person ›empirische Person‹ nennen. Als ›Natur‹ untersteht sie Kausal-,
als ›Geist‹ Sinngesetzen«, wird Edith in ihrer Dissertation schreiben. Die Einfühlung definiert sie als Akt reinen Bewusstseins, der es erlaubt, im Körper des anderen auch gleichsam sein geistig-seelisches Inneres zu »sehen«. Mehr noch: Indem wir empathisch die Sicht anderer auf unsere Person, Gedanken und Gefühle wahrnehmen, öffnen wir uns dafür, das bisherige Verständnis unserer selbst aus der Perspektive Dritter korrigieren zu lassen. Uns selbst als Individuum zu sehen heißt damit, »uns so zu sehen, wie wir einen anderen und ein anderer uns sieht«.
»Im Dienst eines Menschen stehen, kurz gesagt, gehorchen, das kann ich nicht.«
Es ist das Jahr 1915, als Edith ihre akademische Arbeit unterbricht und sich freiwillig für den Lazarettdienst im österreichischen Mährisch-Weisskirchen meldet – als »preußische Staatsangehörige und Jüdin« (wie sich die damalige Patriotin selbst bezeichnete) durchaus auch aus Solidarität mit ihrer Nation. Am liebsten sind ihr die Nachtdienste auf der Typhusstation, da sie sich hier besonders ungestört den Kranken widmen kann.
In Freiburg, wo Husserl inzwischen lehrt, legt sie ihr Rigorosum mit Auszeichnung ab. Der Meister erkennt die »selbstständige« Leistung seiner Schülerin an. Zwar sperrt er sich gegen ihre Habilitation, weil sie ihm mit »dem kulturellen Selbstverständnis des männlichen Gelehrten« (Husserl) unvereinbar erscheint. Dafür darf sie seine Assistentin werden. Das heißt: seine zahllosen, in Kurzschrift verfassten Textfragmente entziffern und die Zettelwirtschaft in eine sinnvolle Ordnung bringen; ein Unternehmen, durch das Edith, die auf eine gleichberechtigte Zusammenarbeit gehofft hat, »halb verblödet«, wie sie in einem Brief an einen Kollegen bemerkt.
Zur gleichen Zeit bekommt sie immer mehr die Auswirkungen des Krieges zu spüren. Die alte preußische Ordnung zerfällt. Viele ihrer Breslauer Studienfreunde sterben im Kampf. Als im November 1917 Edith Steins enger Vertrauter und Freund Adolf Reinach in Belgien »fällt«, stürzt sie das in eine tiefe Krise.
Reinach, wie ihre anderen Freunde aus dem Göttinger Kreis der Husserl-Schüler, schrieb noch an der Front sein letztes Werk: »Das Absolute«. Ein Jahr zuvor hatte er sich evangelisch taufen lassen. Auch Edith hat längst angefangen, sich neben der Philosophie mit Religion und Sinnfragen zu beschäftigen: Wozu machen wir überhaupt Pläne? Welchen Sinn hat unsere Existenz, wenn wir ihre Gründe nicht kennen? Worin besteht menschliche Freiheit wirklich?
Im Februar 1918 beendet sie ihre Assistenzzeit bei Husserl. Sie könne, schreibt sie lapidar in einem Brief, einer Sache dienen, »aber im Dienst eines Menschen stehen, kurz gesagt, gehorchen, das kann ich nicht«.
Im Katholizismus meint Edith zu finden, was sie sucht. Ihre Mutter kann ihr das nicht verzeihen.
Sie lebt nun wieder in Breslau, gibt Privatkurse in Phänomenologie und feilt an einer Habilitationsschrift. Ihre Gedanken kreisen immer weiter um die Frage nach der Beschaffenheit der menschlichen Person und um die Beziehung zwischen Innen- und Außenwelt. 1921 entdeckt Edith die Autobiografie der spanischen Ordensreformerin und Mystikerin Teresa von Ávila (1515–1582). Ediths Begegnung mit der Karmelitin, die zu Zeiten der Spanischen Inquisition nach christlicher Vollkommenheit strebte, ist für sie eine Art Erweckungserlebnis. Hier findet sie den echten Glauben, den sie im Judentum meist vermisst.
In Teresa von Ávila, so kann man vermuten, findet Edith aber auch sich selbst wieder – als die, die sie werden will: eine eigenständige Person, die ihre innere Freiheit nutzt, um zu lernen und um der Gemeinschaft anderer Lernender den Sinn und Wert menschlicher Existenz begreiflich zu machen. Für Edith ist das Wahre nun gleichbedeutend mit Gott – und göttlicher Liebe. Entsprechend ist sie überzeugt, dass sich Wissen allein durch einen metaphysischen »Glaubensakt« fundieren lässt.
Edith konvertiert zum Katholizismus, der Religion der Karmeliterinnen. Diese Form des Christentums erscheint ihr wohl außerdem zu diesem Zeitpunkt am liberalsten (und relativ frauenfreundlich). Ihr treuer Freund Roman Ingarden kann nicht verstehen, was Edith am katholischen »Dogmenapparat« findet. Auguste Stein wird die Entscheidung ihrer Tochter nie mehr verzeihen. Doch Edith ist der festen
Meinung, ihre eigene Individualität sei in der katholischen Gemeinschaft am besten aufgehoben.
Teresa von Ávilas »innere Burg« als Bild von der menschlichen Seele, in die der Mensch sich zurückzieht, um die Liebe Gottes zu empfangen und sie nach außen – durch die Praxis der Nächstenliebe – weiterzugeben, wird zur Erfahrungsgrundlage von Ediths Hauptwerk: »Endliches und Ewiges Sein« (1935–37) verortet den letzten Grund menschlichen Seins im Sein Gottes. Seit Anfang der 1930er-Jahre hat Edith begonnen, sich mit antiker, spätantiker und scholastischer Philosophie auseinanderzusetzen, vor allem mit Thomas von Aquin (1225–1274). Eingehend hat sie sich mit dessen Modifikation der aristotelischen Unterscheidung von Akt und Potenz – als zwei verschiedenen Seinsweisen möglicher und wirklicher Vollkommenheit – befasst.
Auf dieser Basis sucht sie nun nach einer systematischen Verbindung zwischen Mensch, Welt und Gott. Ihre ambitionierte »Seinslehre« soll nicht nur die Sinnfrage klären, sondern auch das methodische Letztbegründungsproblem der Philosophie als Grundlagenwissenschaft lösen – und zwar durch die Ergänzung und Vollendung der Philosophie mittels Theologie. Was Edith als finale Fassung ihrer Habilitationsschrift begreift, stellt eine eigenständig erarbeitete Synthese aus scholastischer (das heißt in ihrem Fall: thomistischer) Seinslehre, moderner Phänomenologie und jüdisch-christlichem Denken dar.
Um größtmögliche begriffliche Genauigkeit und methodische Präzision bemüht, zeigt sie den schrittweisen Aufstieg des Denkens von dem, was ist, zu dem, wem es sich »verdankt«: dem Heiligen nämlich, welches sich auf dem Weg der Kontemplation oder durch verantwortliches Handeln im Schönen, Wahren und Guten offenbart. Das stoffliche Sein des Menschen ist endlich. Es ist nie ganz »aktuell« (voll verwirklicht), verweist aber in seinen individuellen verzeitlichten Ausprägungen auf eine ewige, zeitlose »Wesensform«; Wesen und Seiendes, Form und Stoff, Essenz und Existenz werden in der Substanz Gottes (»ousia im höchsten und eigentlichsten Sinn«) eins.
Die ontologische Gegebenheit seiner Person – das Wesen seines Körper, seiner Seele und seines Geistes – ist dem Menschen immer schon bewusstseinsimmanent: »Nur weil alles endliche Sein im göttlichen ›Ich bin‹ sein Urbild hat, hat alles einen gemeinsamen Sinn«, so Edith. Die menschliche Person ist einzigartig, individuell – sie betrachtet sich selbst »als etwas ›Eigenes‹«, und auch andere sehen sie so. Doch ist sie »als auf sich selbst gestelltes, sein eigenes Wesen umfassendes und entfaltendes Wirkliches« auch Teil des sich jenseits von Begriffen offenbarenden höchsten Seienden, dem göttlichen Ganzen. Das Eigenleben der »Menschenseele« weist sie als »bildenden Geist« aus – welcher seinen Sinn doch nie selbst schaffen kann und sich ihm deshalb hingeben muss.
»Wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht.«
Seit Mitte der 1920er-Jahre ist Edith, inzwischen Lehrerin bei den Dominikanerinnen in Speyer, eine gefragte Rednerin, besonders zu Frauenthemen. Zwar wird sie in ihren Vorträgen nicht müde, politische und rechtliche Gleichheit für ihr Geschlecht zu fordern. Feministin kann man sie aber nicht nennen, nimmt sie doch jenseits individueller Befähigungen die Hingabe an Höheres (auch) als spezifisch weibliche Eigenart an. Im Einklang mit ihrer Überzeugung, dass die menschliche Seele hin zum Göttlichen entfaltet werden will, plädiert die Gläubige als bestmögliche Verwirklichungsform der Frau für die Tätigkeit der Ordensschwester.
1933, im Jahr der Machtergreifung Hitlers, appelliert Edith in einem Brief an den Papst, dass die Kirche ihre Stimme gegen die nationalsozialistischen Verbrechen an den Juden erheben soll. Die Antwort ist Schweigen. Edith verliert ihre Lehrerlaubnis. Noch im selben Jahr tritt sie in das Nonnenkloster Kölner Karmel Maria vom Frieden ein (begründet noch von direkten Nachfolgerinnen Teresa von Ávilas). Ein Schritt, den sie schon lange gehen wollte – jedoch nicht zu Lebzeiten ihrer Mutter. Die politischen Umstände ebenso wie ihr tiefer Glaube zwingen sie dazu.
1935 werden die Nürnberger Rassengesetze verabschiedet. Drei Jahre später siedelt Edith in den Karmel im niederländischen Echt über. Sie erfüllt die ihr aufgetragenen Pflichten und arbeitet weiter an diversen religiösen Schriften. 1942 folgt die katholische Kirche dem Befehl der nationalsozialistischen Sicherheitspolizei. Sie gibt die ihr bekannten katholisch getauften Juden in den besetzten niederländischen Gebieten zum Transport nach Auschwitz frei. Im August 1942 wird Edith Stein im Lager Birkenau in der Gaskammer ermordet.
Ihr Denken steht im Schatten Husserls und Heideggers
Eine umfassende philosophische, historische und biografische Auseinandersetzung mit Husserls ehemaliger Assistentin steht aus. Es ist leicht, die Leistungen einer Philosophin zu relativieren, die im Schatten ihres übermächtigen Nachfolgers Martin Heidegger steht. Es ist auch leicht, Edith Stein unter dem Eindruck ihrer Selig- und folgend Heiligsprechung durch Papst Johannes Paul II. als Mystikerin zu verklären. Viel schwerer scheint es zu sein, sich ihrem Leben und Werk auf objektive Weise zu nähern.
Dieser Text erschien in HOHE LUFT 3/2019. Hier finden Sie unser aktuelles Heft sowie ältere Ausgaben.