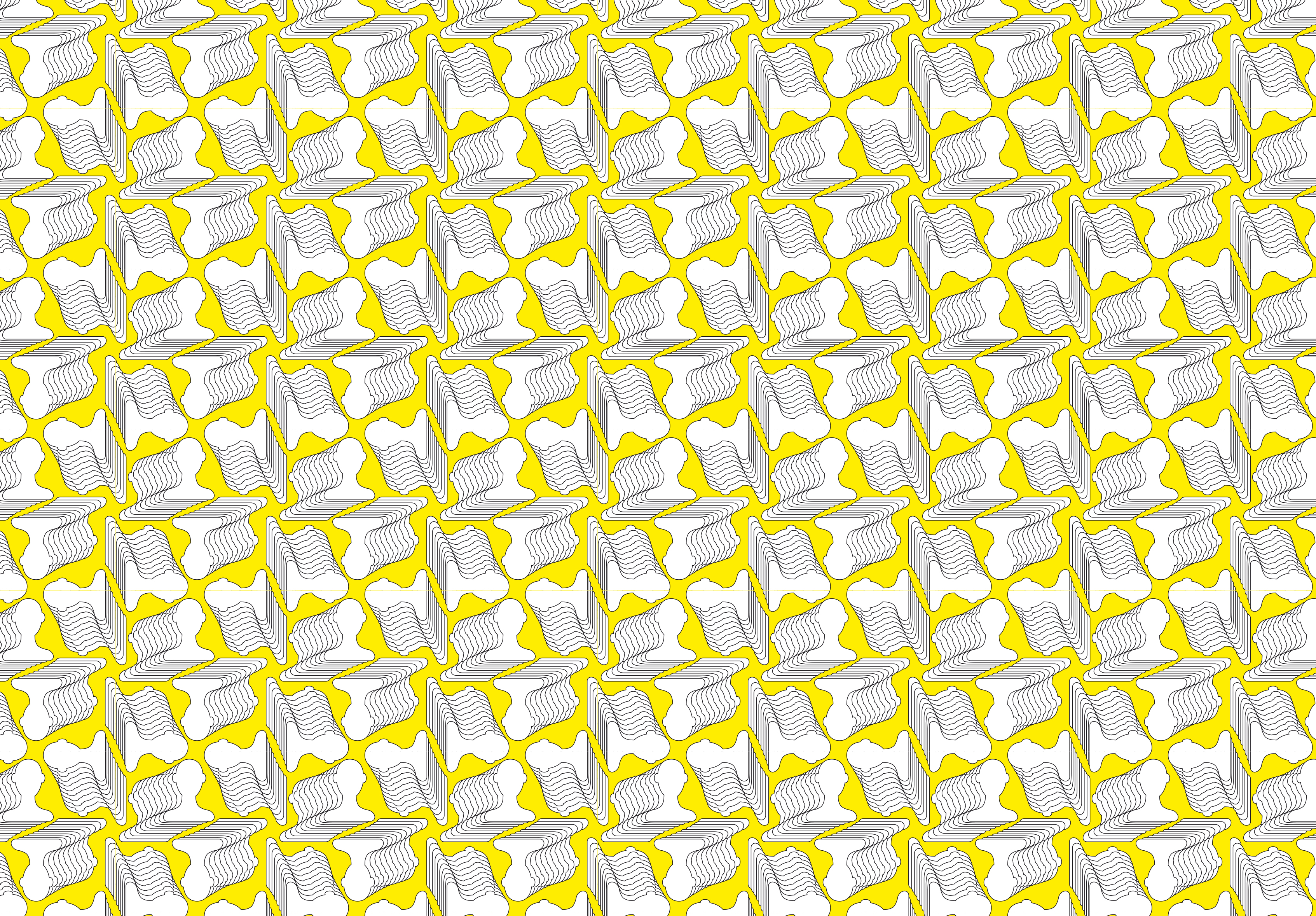China gilt längst als neue Supermacht. Doch was wissen wir eigentlich über dieses Land und sein Denken, seine Ideologie? Kann Konfuzius helfen, das Reich der Mitte zu verstehen? Welche Rolle spielt Chinas Philosophietradition im nationalen Selbstverständnis?
Text: Rebekka Reinhard
Die Chinesen? Leben in einer Diktatur, haben uns Covid-19 beschert, kaufen uns auf und überwachen uns! Das Image Chinas im Westen ist nicht das beste. Großprojekte wie die »Neue Seidenstraße«, das geplante Sozialkredit-System und die Metaplattform Alibaba zeugen von einem aus europäischer Sicht beängstigenden Selbstbewusstsein. Man fürchtet sich vor einer neuen Weltmacht mit globalem Einfluss auf Politik, Wirtschaft und Kultur, die der alten Superpower USA das Wasser abzugraben droht. Doch was wissen wir eigentlich über Chinas Denken, seine Weltanschauung, seine Sprache? Viel zu wenig. Was wissen wir speziell über den Konfuzianismus, in dem sich Moral und Politik vermengen und der für das chinesische Selbstverständnis von großer Bedeutung ist? So gut wie nichts.
UNSERE IGNORANZ GRÜNDET auch auf eurozentristischen Vorurteilen, die uns ernst zu nehmende zivilisatorische Errungenschaften reflexhaft im Abendland verorten lassen. In einer Welt, in der sich die Machtverhältnisse neu ordnen, können wir uns intellektuelle Arroganz aber nicht leisten. In diesem Essay geht es nicht nur um grundsätzliche Unterschiede zwischen westlicher und chinesischer Philosophietradition, sondern konkret auch um zwei neue Publikationen der Philosophen Tongdong Bai und Zhao Tingyang, die sich beide auf den Konfuzianismus berufen. Ich möchte der Frage nachgehen, ob sich diese Werke als ideologische Legitimationsschriften für die politischen Machtbestrebungen des heutigen Chinas interpretieren lassen; oder ob dieselbe Frage bloß ein weiteres westliches Vorurteil widerspiegelt. In Europa und Nordamerika wird chinesische Philosophie hauptsächlich in den Departments der Sinologie vermittelt. In Deutschland hat man überhaupt erst seit gut hundert Jahren begonnen, das chinesische Denken wissenschaftlich zu erforschen – eben nach sprach- und kulturwissenschaftlichen, nicht nach philosophischen Kriterien. Aus gutem Grund, könnte man vorschnell meinen: Sprachliche Charakteristika wie das fehlende Subjekt im Satz oder die fehlenden
Grenzen zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft scheinen für präzise analytische Reflexionen ungeeignet. Wie der Sinologe Wolfgang Bauer (1930–1997) erklärte, hieß in China das, was wir seit Platon »Philosophie« nennen, ursprünglich »Weisheitslehre« (aus dem Japanischen übersetzt: zhexue) beziehungsweise schlicht »Denken« (sixiang). Gemäß der Endung zi ist ein chinesischer Philosoph wörtlich ein »Meister« (Konfuzius/Kongfuzi, Menzius/ Mengzi), vergleichbar einem Künstler, Techniker oder Politiker.
Was die chinesische von der westlichen Philosophietradition unterscheidet, ist ihr Praxisbezug, ihr grundsätzlicher Pragmatismus, der in Anekdoten, Narrativen, argumentativen Skizzen zum Ausdruck kommt. Im Mittelpunkt steht, wie chinesische Philosophiehistoriker meist stolz hervorheben, nicht der elaborierte Systementwurf – sondern der Mensch beziehungsweise die Menschlichkeit (im Chinesischen dasselbe Wort: ren) fernab jeder theoretischen Abstraktion.
DER KONFUZIANISCHE HERRSCHER IST EIN KULTIVIERTER MANN
Es war Konfuzius (»Meister Kong«, 551–479 v. Chr.), der Menschlichkeit als moralische und politische Tugend in den Mittelpunkt chinesischen Denkens rückte. Das konfuzianische Universum ist eine strikt diesseitsorientierte und zugleich hierarchisch strukturierte Welt, in der Riten, Rituale und familiäre Bande für Ruhe, Harmonie und Gleichheit (ch’i) sorgen.
Für Konfuzius sind zwar alle Menschen potenziell (moralisch) gleich, aber nicht alle zu vernünftigen politischen Entscheidungen fähig. Deshalb muss die Welt von einer tugendhaften Autorität mit sogenanntem »Himmels(tian)-Mandat« regiert werden. Konfuzius sieht sich als Erneuerer des Alten; seine historische Referenz ist die ferne Zhou-Zeit (1050–770 v. Chr.), in der das Wort vom Himmel erstmals verweltlicht und als höchste moralische Legitimation des Kaisers begriffen wurde; für die Philosophie wie für den Staatskult Chinas kam dem Himmelskult seither eine immer wichtigere Rolle zu.
Der konfuzianische Herrscher ist zudem ein kultivierter Mann (wie auch Konfuzius selbst), der um die Bedeutung von Bildung weiß: Bildung erwächst aus gewissenhaftem Lernen, das heißt Kopieren und Neuinterpretieren früherer Schriften: »Lernen ohne zu denken ist sinnlos, aber Denken ohne Lernen ist gefährlich« (Konfuzius). Die Überzeugung, dass man aus der Vergangenheit lernen müsse, um daraus pragmatische Schlüsse für Gegenwart und Zukunft zu ziehen, kann man typisch konfuzianisch – und typisch chinesisch nennen. In der zentralistisch organisierten Han-Dynastie (206–220 n. Chr.) – der laut Bauer »grundlegendsten aller chinesischen Dynastien« – wurden Gelehrsamkeit, Bildung und Menschlichkeit zum Fundament politischer (Himmels-)Macht. Der Konfuzianismus verwandelte sich in eine Art Staatsideologie.
Wer an die bald tausend »Konfuzius-Institute« denkt, die die Kommunistische Partei heute weltweit unterhält, um die Verbreitung der chinesischen Sprache und Kultur zu fördern und zu kontrollieren, könnte fast glauben, China wolle zur Han-Zeit zurück. Und was ist mit chinesischen Philosophen, die sich 2020 auf den Konfuzianismus berufen? Sind sie so etwas wie ideologische Botschafter? Ein Buchtitel wie »Against Political Equality« (2020) könnte diesen Verdacht nahelegen. Der Autor dieses Werks, Tongdong Bai, verteidigt den frühen Konfuzianismus als ein Korrektiv für die liberale Demokratie. Bai, der in Shanghai und New York lehrt, erklärt dem (westlichen) Leser, warum man den Liberalismus zwar nicht abschaffen, aber reformieren müsse: Da in modernen Demokratien ein eigennütziger Individualismus zur Elitenfeindlichkeit und zur Benachteiligung schwächerer (Wähler-)Gruppen geführt habe, sei ein »konfuzianistisches hybrides Regime« nötig, in dem sich »meritokratische« mit liberalen Elementen mischen.
UNGEBILDETE SOLLEN KEINEN POLITISCHEN EINFLUSS HABEN
Laut Bai gefährdet die individualistisch gefärbte, partizipative Gleichheit liberaler Demokratien »Mitleid« und Sorge für die Mitbürger wie für Völker anderer Nationen. Konfuzius und seinem Schüler Menzius (372–289 v. Chr.) folgend, sind es für Bai die Lernfähigen und Gebildeten, die »gleicher« seien als alle anderen und dem Volk »dienen« sollten, indem sie über deren Erziehung bestimmten. Wenn Bai seine Auffassung von einer »hierarchischen Gleichheit« zum Wohle des Staates, der Menschlichkeit und der Menschheit insgesamt verteidigt, beruft er sich auch auf John Rawls (1921–2002). Laut Rawls’ »Differenzprinzip« kann der Staat eine Gleichheit durchsetzen, nach der jeder das Seine erhält (was auch die ökonomische Besserstellung bestimmter Gruppen einschließt). Wie Rawls glaubt Bai, dass politische Partizipation Bildung voraussetzt; anders als Rawls meint Bai aber, dass »irrationale«, also ungebildete Menschen keinerlei politischen Einfluss haben sollten. Bai hält das, was er »egalitäre Meritokratie« oder »mitfühlenden Elitismus« nennt, für eine »realistischere Utopie« als das – potenziell illiberale – Rawls’sche Demokratiemodell, wonach jeder eine Stimme hat und jede Stimme zählt.
EIN NORMATIVES ALL-INCLUSIVEMODELL MADE IN CHINA
Bai will den frühen Konfuzianismus wie seine eigenen Thesen als politische Philosophie, nicht als Ideologie verstanden wissen. Dennoch fällt auf, dass Politisches und Philosophisches gerade in den letzten drei Buchkapiteln zusehends verschwimmen (übrigens völlig im Einklang mit dem traditionellen chinesischen Begriff der »Meisterschaft«); etwa wenn Bai, der explizit für die weltweite Verteidigung der (Freiheits-)Rechte eintritt, die Menschenrechtsverletzungen Chinas gegenüber denen arabischer Länder relativiert. Einerseits schreibt er China durchaus gewisse »totalitäre Elemente« zu; andererseits suggeriert er, dass eine normativ verstandene konfuzianische Weltordnung, die »alles unter dem Himmel« (tianxia) vereinte, für Stabilität sorgen und so nicht nur die Defizite westlicher Demokratie, sondern auch die des chinesischen Regimes beheben würde. Zwar plädiert Bai nicht für die chinesische Weltherrschaft – wohl aber für die globale Dominanz einer chinesischen Weltanschauung, die alle, die sich ihr verweigern, als (O-Ton des Autors) »barbarisch« bezeichnen muss.
Nach der alten Vorstellung des chinesischen »Reichs« – wörtlich: »Alles unter dem Himmel« (tianxia) – herrscht der Kaiser im Auftrag des Himmels nominell über die ganze Welt. »Alles unter dem Himmel« heißt auch das Werk von Zhao Tingyang (siehe auch die Rezension in HOHE LUFT 4/2020). Wie Bai wendet sich Zhao an ein chinakritisches westliches Publikum; wie jener verbindet er den moralischpolitischen Begriff des Himmels – den er auch »spirituell« und »unerschöpflich« nennt – mit einer universellen Geltung, die sich gleichsam aus sich selbst heraus legitimiert. Der wesentliche Inhalt des Buchs ist schnell zusammengefasst: Zhao will die Übel der Globalisierung, des (US-) Imperialismus, des Egoismus, des Materialismus, der Technologie und der Moderne überhaupt durch ein normatives All-inclusive-Modell made in China beseitigen: »Das Konzept des Tianxia zielt auf eine Weltordnung, worin die Welt als Ganzes zum Subjekt der Politik wird«, so Zhao. Stabilität, Frieden und Menschlichkeit könne es dauerhaft nur durch die freiwillige »Kooperation und Koexistenz« aller Völker zur »Nutzenteilhabe aller« geben. Das klingt halb utopisch, halb pragmatisch – wie soll man sich eine Welt vorstellen, zu der es zu ihrer eigenen Sicherheit »kein Außen« gibt?
Mit Konfuzius und anderen Quellen aus der Zhou- bis zur Han-Zeit will Zhao tianxia als »Methodologie« nutzen, um aus dem Erbe der Vergangenheit die Zukunft zu gestalten. Der Autor plädiert für eine globale »geistige Revolution«, die durch die Umstrukturierung des Finanzsystems, der modernen Technologien und der sozialen Medien den Weg frei machen soll für tianxia – und das heißt für ihn: für mehr Spiritualität, mehr gegenseitigen Respekt quer durch alle
Hierarchien, kurz: für mehr Menschlichkeit in der Welt. Zhao lädt alle Völker und Staaten ein, sich zur »universellen Volksseele« zu vereinen und sich vom Tianxia-System freiwillig überwachen und regulieren zu lassen – einem System, das, wie er am Ende betont, nicht China gehören, sondern in aller Besitz sein soll.
Ist das noch »Philosophie« oder schon »Ideologie«? Bais Werk erschien in einer Reihe zeitgenössischer chinesischer Titel der Princeton University Press zur »gegenseitigen kulturellen Befruchtung«. Herausgeber ist der in Shandong lehrende Politikwissenschaftler Daniel A. Bell; ein renommierter westlicher Apologet der »politischen Meritokratie« Chinas. Zhao wiederum, vom Suhrkamp Verlag ohne
Weiteres als »einer der bedeutendsten chinesischen Philosophen der Gegenwart« gelobt, ist der Pekinger Akademie der Sozialwissenschaften eng verbunden, einer dem Staatsrat unterstehenden Kaderschmiede.
EIN VERBOT, DIE »FALSCHEN TRENDS« DES WESTENS ZU PROPAGIEREN
Trotzdem gibt es keinen Beweis, dass beide Bücher offiziell autorisiert sind, die Tatsache, dass sie die aktuelle chinesische (Kultur-)Politik verteidigen, sind allenfalls indirekte Hinweise. Interessant ist diesbezüglich das von dem Sinologen Heiner Roetz zitierte, ursprünglich geheime Dokument der »Sieben falschen Trends« von 2013. Darin verbietet die staatliche Führung das Propagieren bestimmter westlicher Werte und Lebensformen, die den chinesischen Sozialismus und die chinesische Parteiherrschaft infrage stellen könnten, unter anderem die konstitutionelle Demokratie, die westliche Zivilgesellschaft, den Neoliberalismus. Sind diese Tabus womöglich in Bais und Zhaos Thesen ein- geflossen?
Es ist schwer, ein Denken zu verstehen, dessen Sprache man nicht spricht – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. In China ist politische Macht seit der Antike, erst recht seit Konfuzius, untrennbar mit einer bestimmten Sprachbeherrschung und Bildungsmoral verbunden. So ist es bis heute. Xi Jinping hat in den ersten fünf Jahren seiner Amtszeit vier Bücher verfasst, darunter seine in 22 Sprachen übersetzte zweibändige Regierungsphilosophie. »Literatur und Kunst sind Seelengestaltungsprodukte, Literaturund Kunstschaffende sind die Ingenieure der Seele«, sagte er 2014 in einer offiziellen Rede – das Gleiche könnte auch für sein Verständnis von Philosophie und Philosophen gelten.
Laut der Sinologin Thekla Chabbi hat kaum ein Präsident vor Xi Jinping einen derart expliziten Kurs in Sachen Sprache und Bildung eingeschlagen – von den Konfuzius-Instituten über die Zensur von Büchern und Zeitschriften bis hin zum strategischen Einsatz von Begriffen. So ist auch die chinesische Bezeichnung für die gigantischen interkontinentalen Handels- und Verkehrsnetze der »Neuen Seidenstraße« nicht zufällig gewählt: »Ein Gürtel, eine Straße« (yi dai yi lu). Wie der »Economist« kürzlich erklärte, lassen die vier Schriftzeichen nicht nur Begriffe wie Stabilität, Harmonie und Ganzheit assoziieren, sondern klingen in chinesischen Ohren fast wie: tianxia – jener auch für Bai und Zhao so wichtigen Vorstellung eines friedvollen, da hierarchisch geordneten Kosmos; eines Welt-»Reichs«, das (zumindest implizit) von China gelenkt wird.
Man kann das pseudophilosophische Propaganda nennen – und Bai und Zhao vorsorglich in die unterste Schublade packen. Lohnender wäre es, die Unterschiede zwischen chinesischem und westlichem Denken noch viel tiefer verstehen zu wollen. Dies würde auch bedeuten, die Vielschichtigkeit und Mehrdeutigkeit der chinesischen Sprache und ihrer Begriffe anzuerkennen. Die konfuzianische »Menschlichkeit« etwa ist eben nicht nur ein traditionelles ideologisches, sondern auch ein philosophisches Konzept, das sorgende soziale Bindungen stark macht – wenn auch unter dem Vorzeichen einer Gleichheit, die (modernen) westlichen Vorstellungen von Gerechtigkeit und Selbstverwirklichung widersprechen.
Eben deshalb gälte es, meine ich, sich weit gründlicher und objektiver mit der Tradition chinesischen Denkens zu befassen, als es die meisten westlichen Philosophen und Intellektuellen bisher tun. Man könnte damit anfangen, sich mit der speziellen chinesischen Zeitlichkeit vertraut zu machen. Einem »flächigen Zeitbegriff« (Wolfgang Bauer), der nicht zwischen einzelnen Tempi trennt; der die weit zurückliegende
Vergangenheit als ebenso beweglich und »im Kommen« begreifen kann wie die Zukunft. Wenn sich das Denken chinesischer »Meister«-Philosophen aus einem gleichsam ewigen Jetzt speist, hat es womöglich einen längeren Atem als die abendländische Philosophie, die ähnlich intensiv aus ihrer eigenen Vergangenheit schöpft – und in dieser erstarrt zu sein scheint.