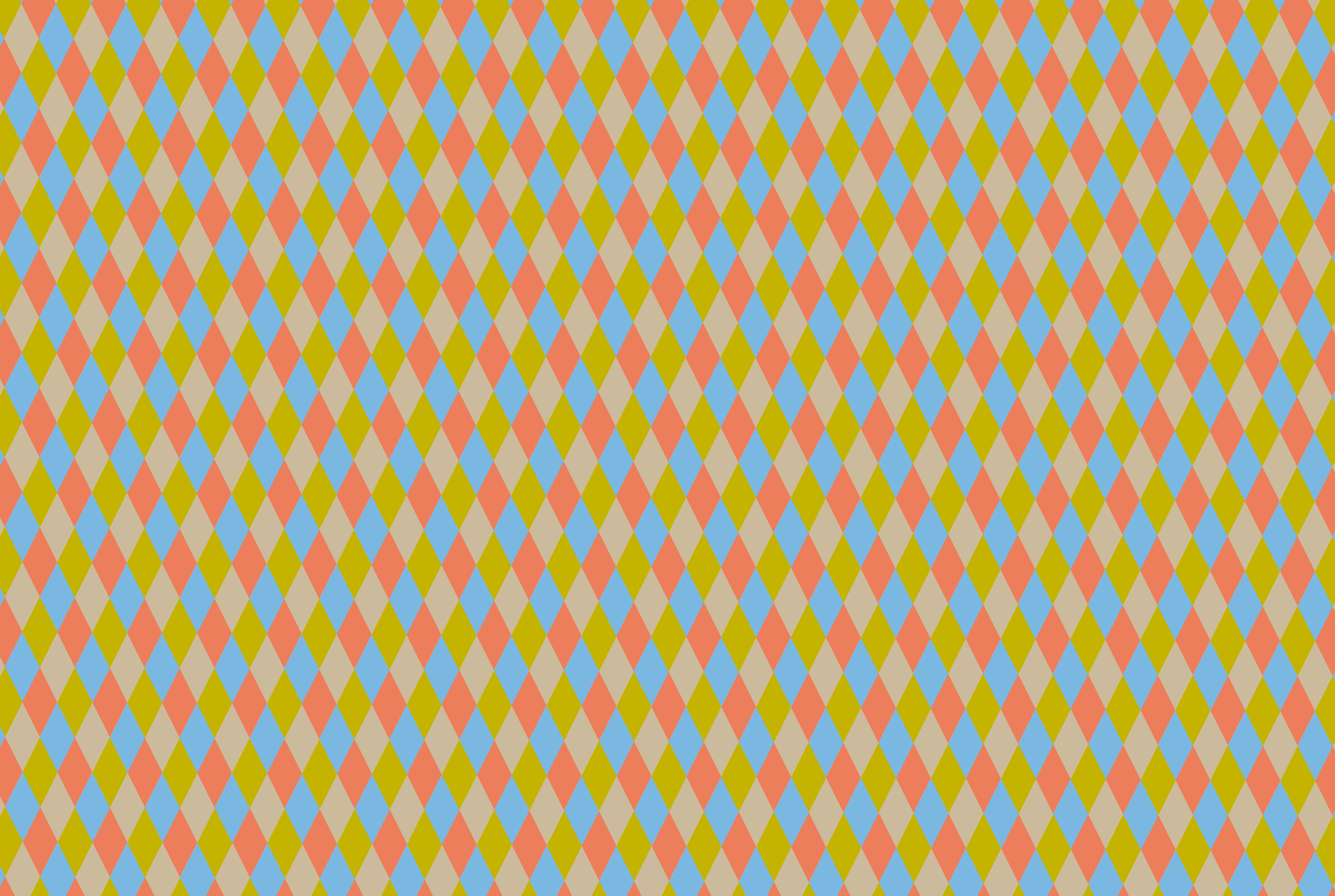Das Gute am Wein ist, dass man so gut über ihn philosophieren kann. Die Frage ist bloß: Sind die ihm zugeschriebenen Eigenschaften wie »Tiefe«, »Fülle« oder »Maracujanoten« Bullshit? Oder ist etwas dran? Und was hat das mit Immanuel Kant und David Hume zu tun?
Text: Tobias Hürter und Thomas Vašek
Antizyklisches Feiern besteht zum Beispiel darin, am Eröffnungsabend des Oktoberfestes durch die Münchner Weinlokale zu ziehen. Wenn die bayerische Hauptstadt und die halbe Welt sich am Bier berauschen, hat man den Wein für sich. So ist das Oktoberfest auch eine Chance für die Philosophie. Eine Gruppe von Weinexperten und Philosophen nutzte jenen Abend, um den Zusammenhang zwischen Denken und Trinken näher zu untersuchen. Mit dabei: Jakob Steinbrenner,
Philosophieprofessor in Stuttgart, das Winzerpaar Florian und Ulrike Weingart aus Spay am Rhein sowie die Chefredaktion von HOHE LUFT, Thomas Vašek und Tobias Hürter – letztere zwei blutige Weinlaien.
Wein ist ein altbewährtes Hilfsmittel der Philosophen. Sokrates, ihr aller großes Vorbild, kam denkerisch erst richtig in Fahrt, wenn er in Gesellschaft und auf Pegel war, so hat es Platon in seinem »Gastmahl« dokumentiert. Weniger bekannt ist, dass Wein zugleich ein heißes Thema der zeitgenössischen Philosophie ist. Dahinter stecken Fragen wie: Sind Geschmacksurteile objektiv? Haben sie Sinn und Bedeutung? Was ist natürlich, was ist künstlich? Für diese und andere Rätsel ist Wein ein guter Testfall. Eine neue Disziplin ist entstanden: die Philosophie des Weins. Es gibt Tagungen, Sammelbände und manchmal auch Streit. Weinkenner schwenken den teuren Saft gern mit heiligem Ernst durch bauchige Gläser, beschnüffeln ihn mit fast obszöner Ausgiebigkeit, wälzen ihn feierlich mit der Zunge durch den Mundraum und sprechen dann von einer Note frischen Grases, einem Hauch Lakritze im Abgang, aber auch von feuchter Pappe, Katzenpisse oder merde de cheval. Das klingt dann etwa so: »Sehr komplex und voluminös, mit großer Tiefe in der Frucht und einem gut definierten mineralischen Akzent.« Oder: »Lebhaft in der Frucht, seidig und geradlinig.« Und Weinlaien fragen sich: Pferdeäpfelaroma im Wein – was reden die da? Alles nur Show? Oder ist da wirklich was dran?
Genauer gefragt: Worauf beziehen sich die Urteile eines Weinschmeckers, auf objektive Eigenschaften des Weines, auf ein rein subjektives Erleben des Schmeckers – oder auf gar nichts? Ist das Gerede bei Weinverkostungen bloß Bullshit? Dieser Glaube ist verbreitet, und einige wissenschaftliche Studien scheinen ihn zu stützen. Mit einer simplen mathematischen Formel, die aus Wetterdaten die Preise alter Jahrgangsweine vorhersagte, konnte der Princeton-Ökonom Orley Ashenfelter die in der Szene hoch gehandelten Bewertungen des amerikanischen Weinkritiker-Gurus Robert Parker (»Parker-Punkte«) nachvollziehen. Ein Team der Heriot-Watt-Universität Edinburgh beobachtete im Jahr 2008, dass Hintergrundmusik die Bewertungen von Weinverkostern erheblich verändert. Ein Gitarrenriff von Jimi Hendrix verbessert demnach einen Cabernet Sauvignon. Kylie Minogue dagegen passt gut zum
Chardonnay. Weinverkosten sei »junk science«, schrieb darauf die englische Zeitung »The Observer«. Erste unsystematische Experimente an jenem Abend wiesen jedoch in eine andere Richtung. Getrunken wurde vor allem Riesling verschiedener Provenienzen, wobei sich in den Zuschreibungen der Experten und Laien eine erstaunliche Übereinstimmung zeigte. Jakob Steinbrenner wies auf die Johannisbeernote hin. Ja, da ist eindeutig Johannisbeere, fiel nun
auch den Laien auf, die es vorher nicht bemerkt hatten. Ulrike Weingart monierte eine »Schärfe im Abgang«. Es saß niemand am Tisch, der sie nicht schmeckte.
Sind Geschmacksurteile objektiv? Haben sie Sinn und Bedeutung? Für diese und andere Rätsel ist Wein ein guter Testfall.
Tatsächlich spricht manches dafür, dass Weinverkoster nicht einfach nur so reden, sondern auch über etwas reden. Wenn sie zum Beispiel »frisches Gras« schmecken, dann hat der Rebensaft an ihrem Gaumen höchstwahrscheinlich einen erhöhten Gehalt an 1-Hexanol, einem angenehm süßlich riechenden Alkohol. Der weniger angenehme Beigeschmack von »grüner Paprika« kommt von Methoxypyrazinen, einer Gruppe natürlicher Duftstoffe, die auch der Kartoffel ihr erdiges Aroma verleihen. An der Universität Geisenheim im Rheingau – sozusagen dem MIT der Önologen schmecken die angehenden Weinprofis sich in die Maracujanote hinein, indem sie nach einem standardisierten Verfahren echten Maracajusaft in Weißwein mischen. Sie meinen also tatsächlich Maracuja, wenn sie »Maracuja« sagen. Solche Urteile sind intersubjektiv, reproduzierbar und haben eine chemische Grundlage. Junk science? Mitnichten. Die Frage nach Sinn und Bedeutung solcher Geschmacksurteile sollte dabei nicht nur Weinfreunde interessieren. Ein Urteil zu fällen, so sprach einst Immanuel Kant (1724 –1804), heißt, einem Gegenstand eine Eigenschaft zuzuschreiben. Also zum Beispiel einem Ball die Eigenschaft, rund zu sein. Oder einem Riesling die Eigenschaft, scharf im Abgang zu sein. Ein Urteil ist nach Kant ein wahrheitsfähiger Gedanke. Aber: Was macht den Gedanken dann wahr oder falsch? Wo liegt die Instanz, die über Wahrheit und Falschheit entscheidet? Im Fall von »Der Ball ist rund« lokalisiert man sie im Ball. Jeder kann an ihm nachmessen, ob er rund ist. Einen
American Football kann man nicht rund reden. Doch wie schaut es mit »Dieser Riesling hat einen scharfen Abgang« aus? Ist das tatsächlich eine Aussage über den Riesling, oder gibt der Trinker damit nur etwas rein Subjektives über sein Geschmackserleben kund, etwa wie in »Ich habe Schmerzen«? Auf die Schärfe im Abgang kann man nicht deuten wie auf die spitzen Enden eines Footballs. Allenfalls kann man auf seinen Mund deuten und sagen: »Dort habe ich Schmerzen.« Ähnlich verhält es sich beim Thema Farben. Worin liegt das Blau aus der Beobachtung »Der Himmel ist blau«, im Himmel oder im Beobachter? Verkündet der Beobachter nur, dass er gerade ein Blau-Erlebnis im Zusammenhang mit dem Himmel hat, oder sagt er etwas über den Himmel, das unabhängig von seinem Erleben ist? Wer auf diese Möglichkeit tippt, muss wissen, dass es bisher niemandem gelungen ist, physikalische Substrate für Farbempfindungen zu finden. Niemand kann sagen, was die Farbe Blau ist, physikalisch gesehen. Und doch haben wir die feste Intuition, dass die Farben irgendwo da draußen sind. Wenn einer blau sieht, dann sehen es meistens auch die anderen. Es funktioniert, auch wenn nicht klar ist, was die Eigenschaft Blau wahrheitsfähig macht.
Wovon rede ich, wenn ich einen Wein füllig nenne – was sind die Wahrheitsbedingungen von Fülle?
Beim Wein ist die Intuition wackliger. Wovon rede ich, wenn ich einen Wein füllig nenne – was sind die Wahrheitsbedingungen von Fülle? Das richtige Verhältnis bestimmter Inhaltsstoffe? So gelangt man von einem guten Glas Wein stracks in den tiefsten Morast der Philosophie. Schon seit Jahrtausenden zerbrechen sich Philosophen die Köpfe darüber, was Eigenschaften sind. Nicht wenigen Philosophen wäre es am liebsten, wenn es Eigenschaften gar nicht wirklich gäbe, sondern nur die Dinge, denen wir sie zuschreiben. Aber ohne Eigenschaften scheint es nicht zu gehen. Es ist verzwickt. Da ist einerseits die feste Überzeugung, dass man etwas sagt, wenn man »Der Himmel ist blau« sagt. Nur was? Zum anderen gibt es bei den komplexen Eigenschafte von Wein noch weitere Grade der Verzwicktheit. Am einfachen Ende der Skala liegt die »Länge« eines Weins: die Zeitdauer, in der ein Schluck am Gaumen nachklingt. Sie lässt sich mit der Stoppuhr messen. Bei der »Fülle« eines Weins wird es schon schwieriger. Sie hängt zusammen mit seinen Anteilen von Alkohol, Säure, Glycerin, Phenolen und Gerbstoffen. Aber ist es das, was wir meinen, wenn wir ihn »füllig« nennen? Noch
komplizierter wird es, wenn jemand beispielsweise einen Rheingau Riesling als »schlaff« oder »flach« bezeichnet. Das sind offenbar Metaphern. Wenn er dann fordert: »Dieser Riesling bräuchte mehr Tiefe«, was genau fordert er dann? Am oberen
Ende der Verzwicktheitsskala liegen die Werturteile. Was soll einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden? Reine Geschmackssache, so scheint es.
Bemerkenswert dabei ist jedoch, wie konsistent erfahrene Weintrinker sind, wenn sie Weinen Eigenschaften zuschreiben – auch wenn sie in der Bewertung dieser
Eigenschaften nicht immer übereinstimmen. Auch an jenem Abend zeigte sich ein solches Maß an Übereinstimmung zwischen den Trinkern verschiedenster Hintergründe, dass die Folgerung nahe lag: Weinverkostung ist kein Bullshit. Es war möglich, präzise über den Wein zu kommunizieren – selbst ohne dass das Rätsel der Eigenschaften im Einzelnen gelöst war.
Der englische Philosoph Cain Todd kommt in seinem Buch »The Philosophy of Wine« zum gleichen Ergebnis. Man muss den Urteilen über Wein eine gewisse Objektivität zusprechen. Einen Weinrealismus verwirft Todd jedoch. Ein Wein ist nicht »voll«, wie eine Flasche »voll« ist. Objektivität ohne Realismus, wie geht das? Vor ähnlichen
Schwierigkeiten stand einst der schottische Philosoph David Hume (1711–1776), als er sich mit der Frage beschäftigte: Was sind die Maßstäbe, nach denen wir gute und schlechte Schriftsteller unterscheiden? In seinem kurzen und in Eile verfassten, aber für die Entwicklung der Ästhetik wegweisenden Essay »Of the Standard of Taste« stellt Hume fest, dass die Geschmäcker auf den ersten Blick unvereinbar verschieden scheinen. Doch diese Verschiedenheit kommt nicht daher, dass jeder von einem Werk halten kann, was er will, so argumentierte Hume, sondern daher, dass Leser Fehler machen und Vorurteile haben. Wenn sie etwas nachdenken und sich informieren würden, dann würden sie alle zu gleichen Urteilen kommen. Daher setzte Hume als Maßstab für gute Werke das einstimmige Verdikt der Experten, wobei Experten jene Leser sind, die folgende fünf Voraussetzungen in ausreichendem Maß mitbringen:
1. Kognitive Fähigkeiten
2. Feine Wahrnehmung
3. Erfahrung
4. Vergleichsmöglichkeiten
5. Unvoreingenommenheit
Für Hume war die Güte eines Werks also durchaus eine Sache des Gefühls – des Wohlgefallens, das das Werk in uns weckt. Aber dennoch war er überzeugt, dass manche Werke objektiv gesehen besser als andere sind, weil sie dem kompetenten Leser besser gefallen. Ähnlich wie Hume es mit der Literatur hielt, so hält Cain Todd es mit dem Wein. Man könnte seine Betrachtungen als »antirealistischen Weinobjektivismus« bezeichnen. Die Güte eines Weins ist Geschmackssache, aber Geschmack ist nicht beliebig. »Man sollte die feine Balance eines ›Château Figeac‹ zu bemerken versuchen, sonst verpasst man etwas von Wert, das da zu erfahren ist«, so Todd. Allerdings lässt er Spielraum bei der Bewertung von Weinen.
So zerstritten sich etwa die großen Weinkritiker – die Britin Jancis Robinson und der Amerikaner Robert Parker – heftig über die Bewertung des Bordeaux-Weins ›Château Pavie 2003‹. Robinson fand ihn »völlig unappetitlich«, Parker pries ihn als »großen Wein«. Todd bleibt dennoch dabei, dass die beiden grundsätzlich das Gleiche schmeckten. Beide nahmen die Fruchtaromen des »Pavie« gleich wahr. Nur bewerteten
sie sie anders. Robinson fand sie zu untypisch für Bordeaux. Wäre es ein Zinfandel gewesen, hätte sie ihn vielleicht gelobt. Parker hatte offenbar ein flexibleres Verständnis von Bordeaux- Wein. Kein Wunder also: verschiedene Maßstäbe, verschiedene Urteile. Es kommt immer auch darauf an, welche Vorstellungen wir von den Dingen haben.
Es waren Philosophen anwesend an jenem weinseligen Abend in München, als das Oktoberfest eröffnet wurde, daher musste früher oder später die Frage aufkommen: Was ist Wein überhaupt? Lange konnte man in Deutschland jederlei Gebräu als Wein deklarieren, auch wenn es nur aus Rosinensaft und Alkohol zusammengemischt war. Erst 1909 stellte ein Gesetz klar: »Wein ist das durch alkoholische Gärung aus dem Saft der frischen Weintraube hergestellte Getränk.« Heute ist Wein vom europäischen Weinrecht geregelt: »Wein ist das Erzeugnis, das durch vollständige oder teilweise Gärung der frischen, auch eingemaischten Weintrauben oder des Traubenmostes gewonnen wird.« Ganz in EU-Manier folgt dann allerdings ein Dickicht von konkretisierenden Gesetzen und Ausführungsbestimmungen, die den Weinbegriff dann wieder aufweichen. So ist es doch wieder ein Stück Ansichtssache, wie ein richtiger Wein zu entstehen hat. Manche Winemaker im kalifornischen Napa Valley, dem Silicon Valley der globalen Weinbranche, zerlegen ihre Produkte in ihre chemischen Komponenten und setzen sie dann wieder zusammen. Dagegen legen europäische Winzer wie Florian Weingart großen Wert auf Natürlichkeit. »Es ist immer noch die Natur, die den Wein macht«, sagt er, »der Winzer begleitet ihn nur.« Manche Winzer kennen jeden ihrer Weinstöcke persönlich, sie wenden von Hand die Blätter, um den Trauben das richtige Maß Licht zukommen zu lassen. Für Weingart ist es eine Frage der Ethik, seinen Wein auf möglichst natürliche Weise entstehen zu lassen. Er ist dabei, eine umfassende Weinethik zu entwickeln – von der Herstellung bis zum Trinken –, über die er gerade auch ein Buch schreibt. Wenn man Wein als natürliches Produkt versteht, dann hat das Folgen für seinen ästhetischen Status. Er kann kein Artefakt, kein Kunstwerk sein, denn er wurde nicht von einem menschlichen
Künstler geschaffen, sondern von der Natur. Zwar trägt Wein Züge von Kunstwerken: Er weckt jenes »interesselose Wohlgefallen«, das Kant als Kennzeichen der Schönheit setzte. Aber Wein sagt nichts aus, da ihm niemand eine Bedeutung gegeben hat. Ein Kunstwerk ist Wein nicht. Im Laufe jenes Abends zeigte sich wieder einmal, dass Wein nicht nur gut schmeckt, sondern auch berauscht. Die Sprache wurde blumiger, die Gestik ausladender, die Urteile wurden gewagter. Eine der großen Fragen der Weinphilosophie ist, inwiefern sich der Weinrausch von anderen Räuschen, etwa dem Bierrausch, unterscheidet.
Der englische Philosoph Roger Scruton hält den Weinrausch für überlegen: »Der erste Schluck eines guten Weins rührt in mir, wenn er seinen Weg nach unten nimmt, den verwurzelten Sinn meiner Fleischlichkeit. Ich weiß, dass
ich Fleisch bin.« Auf diese Weise, so Scruton, führt uns der Wein »die grundlegende Einheit von Geist und Körper vor. Die herzwärmende Flüssigkeit scheint Botschaften mitzubringen, die an die Seele gerichtet sind. Aber sie tut dies durch Veränderungen des Körpers.« Bier fehle diese einsichtsfördernde Wirkung, behauptet Scruton. Er verweist auf den Biertrinker Arthur Schopenhauer (1788–1860), dessen Philosophie »nicht Frieden, sondern ewige Unruhe« verspreche. Schopenhauers Denken hätte einen besseren Weg genommen, mutmaßt Scruton, wenn dieser die Gewohnheit gepflegt hätte, »jeden Abend ein Glas vors Gesicht zu nehmen, in dem das Ich auf seine eigene Reflexion trifft«. Wäre Scruton an jenem Abend dabeigewesen, hätte
er vielleicht triumphierend auf all die Tausenden Besucher des Oktoberfestes gezeigt, die nach 23 Uhr grölend und erbrechend aus den Bierzelten getorkelt kamen. Von Reflexion auf die Einheit von Geist und Körper war bei ihnen nichts zu erkennen. Daraus folgt jedoch nicht, dass man nicht auch zu Bier philosophieren könnte. Wir tun es des Öfteren.