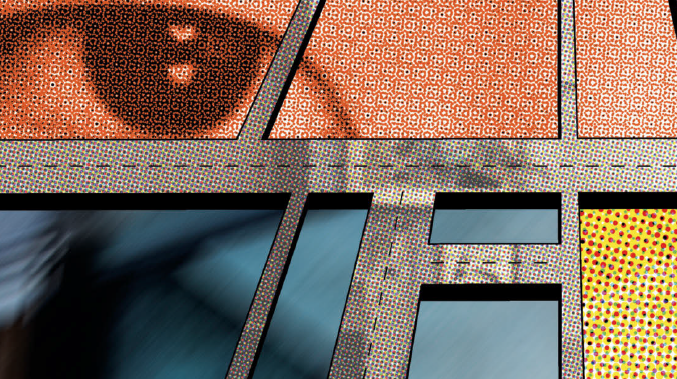Der bekannte Staatsrechtler Christoph Möllers wird für sein Buch »Freiheitsgrade« 2021 mit dem renommierten Tractatus-Essaypreis des Philosophicum Lech ausgezeichnet. Wir sprachen mit dem Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin im Herbst 2020 über die Coronakrise, politischen Liberalismus und das Verhältnis von Wahrheit und Freiheit und Demokratie.
Interview: Thomas Vašek
Illustration: Gabriele Dünwald
HOHE LUFT: Herr Möllers, inwieweit bedroht die Coronakrise unsere Freiheit?
CHRISTOPH MÖLLERS: Ich würde nicht mehr von Bedrohung reden, wir sind ja real eingeschränkt. Wir haben Verluste an Freiheit, die wir auch nicht wieder einholen können. Die Frage ist, welche langfristigen Folgen das hat. Man kann sich vorstellen, dass es Gewöhnungseffekte gibt. Es wäre ein Problem, wenn die Gesellschaften sich auf Dauer zu sehr daran gewöhnten, dass sie derart eingeschränkt werden – selbst wenn dies aus vernünftigen Gründen geschieht.
Wie würden Sie als Staatsrechtler den derzeitigen Zustand beschreiben? Ist das noch die rechtsstaatliche »Normallage« – oder tatsächlich ein Ausnahmezustand, wie manche glauben?
Das ist eine interessante Frage, die darauf hinweist, dass wir einen Begriff bräuchten, den wir nicht haben. Die Rede vom Ausnahmezustand ist zu stark konnotiert, sie unterstellt auch autoritäre Absichten, die ich nicht zu erkennen vermag. Gleichzeitig befinden wir uns in Deutschland aber in einem relativ parlamentsfreien Zustand, was Eingriffe in die Freiheit angeht. Das empfinde ich als ein institutionelles Problem. Es gibt einen institutionellen Konsens, der den Exekutiven überantwortet wird, aber keine parlamentarischen Verfahren, die das verarbeiten. Dafür habe ich auch keinen Begriff, aber ich würde sagen, das ist auf Dauer nicht zu akzeptieren. Wir bräuchten tatsächlich eine Re-Vergesetzlichung, eine Re-Parlamentarisierung des Zustandes. Das wäre auch möglich.
Werden die Coronaregeln überhaupt noch von der Politik gemacht? Oder regiert die epidemiologische Notwendigkeit?
Politik ist das schon. Es ist vielleicht nicht die Politik, die im parlamentarischen Regierungssystem so vorgesehen ist. Man sieht aber, dass die Politik auf Unmut oder Unverständnis reagiert und anders reguliert, als sie es vielleicht vorgehabt hat. Ich würde also nicht sagen, dass wir mit Alternativlosigkeiten regieren. Zugleich muss man zur Kenntnis nehmen, dass ein Virus anders funktioniert als Geldpolitik. Der Gegenstand, mit dem wir es zu tun haben, ist kausalgesetzlich härter verdrahtet als wirtschaftspolitische Fragen. Man kann viel über Sachzwänge klagen und klagen, das sei das Ende der Politik. Aber die Sache funktioniert eben auch anders, das Phänomen ist kausalistischer. Das zur Kenntnis zu nehmen heißt noch nicht, auf Politik zu verzichten.
Wenn man nicht langfristig Probleme antizipiert, dann hat man kurzfristig einen starken Freiheitsverlust.
Was können wir aus der Pandemie im Hinblick auf Freiheitsbeschränkungen lernen?
Wir müssen mehr über die Zeitstruktur solcher Dinge nachdenken. In der Pandemie zeigt sich ja: Wenn man nicht langfristig Probleme antizipiert, dann hat man kurzfristig einen starken Freiheitsverlust. Das gilt analog auch für den Klimawandel. Der liberale Aspekt der Nachhaltigkeitsdiskussion besteht in dieser Einsicht: Wenn man versucht, Entwicklungen über Jahrzehnte zu antizipieren, dann ist das, was man dann tun muss, viel freiheitsschonender und unauffälliger, als wenn das Hochwasser schon in der Tür ist oder das Virus im Krankenhaus. Langfristiges Handeln ist für viele Menschen auf egalitäre Weise freiheitsschonender als eine kurzfristige Krisenintervention, bei der man dann wirklich hart werden muss und die Leute zugleich ungleich trifft.
In Ihrem Buch »Freiheitsgrade« entwickeln Sie eine neue Theorie der Freiheit. Was ist Ihre Kritik am traditionellen Liberalismus?
Ganz holzschnittartig gibt es zwei Arten von liberaler Theorie. Das eine sind die Theoretiker aus der kantianischen Tradition, die Politik stark mit Vernunft und Rationalität gleichsetzen und deshalb für den politischen Prozess nicht mehr viel übrig lassen. Auf der anderen Seite stehen die Vertreter der Hume’schen Tradition, die Freiheit als Befriedigung von Individualinteressen verstehen und deswegen dem politischen Prozess auch nicht viel Raum geben. Wenn man Politik als etwas Kollektives und Kontingentes versteht, dann haben beide Traditionen dafür wenig Sinn. Mich hat interessiert, wie man liberale Theorie betreiben und trotzdem einen affirmativen und selbstständigen Begriff von Politik behalten kann.
Welche Dimensionen hat die Freiheit?
Erstens steht Freiheit Individuen und Gemeinschaften zu. Es gibt keinen Primat der individuellen vor der kollektiven Freiheit. Man muss sich klarmachen, dass der Schutz individueller Freiheit das Ergebnis einer politischen Entscheidung ist, die erst mal Individuen überhaupt als Individuen definiert und ihre Schutzwürdigkeit stipuliert. Individuelle Freiheitsspielräume entstehen durch gemeinschaftliches politisches Handeln. Zweitens kann Freiheit rational gerechtfertigt wie auch willkürlich wahrgenommen werden. Das Interessante an der Politik ist, dass wir immer auch Bedürfnisse anerkennen und schützen, die sich nicht rational rechtfertigen lassen, dass wir an einem bestimmten Punkt aber doch verlangen, dass diese Bedürfnisse gerechtfertigt werden. Man kann den politischen Prozess also weder auf Bedürfnisbefriedigung noch auf Rationalisierbares reduzieren. Drittens kann Freiheit im Rahmen einer formalisierten Ordnung wie auch außerhalb dieser wahrgenommen werden. Bei Kant oder John Stuart Mill gibt es die Vorstellung, dass sich Freiheit innerhalb einer Parzelle abspielt und dort endet, wo die Freiheit des anderen beginnt. Wir haben aber permanent Überlappungen von Freiheit, die Freiheit des einen kann auch zur Freiheit des anderen beitragen. Das Ausdefinieren solcher Parzellen ist ein ständiger offener Prozess. Grundeigentum funktioniert eben anders als Meinungsfreiheit. Auch wenn ich jemanden legal kritisiere oder verunglimpfe, kann ich damit seine Freiheit beschränken.
Wahrheit wird gerade dadurch dokumentiert, dass wir uns überraschen lassen, dass wir die vorab formulierten Erwartungen auch widerlegen oder enttäuschen können.
Die liberale politische Theorie in der Tradition Kants beruht wesentlich auf rationaler Verständigung über richtige Gründe – auf der Vorstellung eines »zwanglosen Zwangs des besseren Arguments«, wie Habermas sagt. Warum zweifeln Sie an der politischen Bedeutung von Gründen?
Gründe funktionieren nicht, wie sie im Seminarraum funktionieren – in einem Raum, in dem sich jeder Grund frei entfalten kann, ohne von vornherein durch politische Kraftfelder verbogen zu werden. Das spricht nicht dagegen, mit Gründen zu operieren. Man muss sich nur klarmachen, was man tut. Wenn man politisch handelt, wird man sich nie auf Gründe beschränken können. Wir müssen vorsichtig sein, Freiheit nur als Freiheit zum vernünftigen Handeln zu verstehen. Das ist sehr unpolitisch, weil wir uns nie einigen können, was vernünftiges Handeln ist. Und es ist auch ein bisschen autoritär.
In Ihrem Buch plädieren Sie für »ergebnisoffene« Verfahren, die keine normative oder politische Wahrheit voraussetzen. Warum?
Es beginnt mit der Beobachtung, dass es in Ordnungen, in denen es keine freien Wahlen gibt, auch keine ergebnisoffenen Gerichtsverfahren und keine offenen Experimente gibt. Im Totalitarismus werden eben nicht nur Wahlen gefälscht, sondern auch Erkenntnisse unterdrückt. Bei Orbán wäre das die Beobachtung der Demografen, dass die Leute, die aus Ungarn auswandern, mehr Kinder kriegen als die Leute, die in Ungarn bleiben. Ergebnisoffenheit heißt erst mal, dass man einen Zustand ausdefiniert, den man mit unterschiedlichen Verlaufsmöglichkeiten versieht, und dann aber jede dieser Verlaufsmöglichkeiten akzeptiert. Dieser Sinn für Kontingenz geht illiberalen Ordnungen ab.
Läuft eine solche Ergebnisoffenheit aber nicht darauf hinaus, Wahrheitsansprüche zu relativieren?
Im Gegenteil. Das bedeutet es gerade nicht, weil wir ja sagen würden, dass sich Wahrheit in solchen Verfahren überhaupt erst zeigt, etwa bei gerichtlichen Verfahren in der Beweisaufnahme, bei wissenschaftlichen Experimenten wie auch in der politischen Willensbildung, die zu einem überraschenden Ergebnis kommen kann. Wahrheit wird gerade dadurch dokumentiert, dass wir uns überraschen lassen, dass wir die vorab formulierten Erwartungen auch widerlegen oder enttäuschen können. Wenn Liberalismus immer etwas zu tun hat mit den Grenzen der Intervention von Politik, dann ist die Grenze der Intervention von Politik auch die Grenze der Intervention in Verfahren, egal wie sehr man sich einen bestimmten Ausgang wünscht.
Verstehen Sie demokratische Prozesse also als eine Art experimentelle Verfahren?
Auf jeden Fall. Weil es bei Experimenten immer um Ergebnisoffenheit geht. Die Möglichkeit zu scheitern und es hinterher anders machen zu können, das ist ja die eigentliche Pointe des Experiments …
… um was damit herauszufinden?
Um herauszufinden, ob man bestimmte Zwecke mit bestimmten Mitteln erreichen kann. Das ist das elementare politische Experiment, das dadurch komplex wird, dass man mit der Beobachtung der Zweck-Mittel-Beziehung auch immer wieder die Zwecke anpassen wird.
Wenn ich es richtig verstehe, dann ist das Ziel solcher experimentellen politischen Verfahren also kluges Handeln?
Klar, aber es kommt noch vieles andere hinzu. Wie gehe ich eigentlich mit Leuten um, die andere politische Überzeugungen haben? Mit denen gehe ich eben listig und strategisch um. Weder will ich sie therapieren noch sie überzeugen. Dieser genuin politische Umgang kommt in der Theorie zu kurz: Was ist politische Kommunikation? Und was ist das eigentlich für ein Raum, in dem ich jemanden anflunkern oder über den Tisch ziehen darf?
Gerade angesichts der schweren Einschränkungen: Wie kann man denn einer so flunkernden Politik noch vertrauen?
Jedenfalls nicht nur dadurch, dass man auf die moralische Integrität der Beteiligten hofft, sondern auch dadurch, dass man sich deren Interessen anschaut und sich ein eigenes Urteil von den Zuständen macht. Man darf das Wissen der anderen, auch der Politik dabei, auch nicht überschätzen.
Wahrheit ist ein Mittel zum Zweck, Freiheit in sinnvoller Form auszuüben.
Welche Rolle spielt dann der Wahrheitsbegriff in Ihrem Verständnis von politischem Liberalismus?
In meinem Verständnis von Liberalismus ist der Wahrheitsbegriff wichtig, aber prekär. Einerseits würde ich den Begriff der Wahrheit nicht aufgeben, andererseits aber gibt es den starken politischen Instinkt, dass sich das richtige Verfahren zur Ermittlung von Wahrheit immer in einem nicht vorherbestimmten und zumeist umstrittenen Prozess zeigt. Diese Intuition ist natürlich schwer zu verkaufen – dass man weder auf den Begriff verzichtet noch ihn so stark einhegt, dass man schon weiß, wo die Wahrheit ist. Dass man ihn also prekär belässt, aber zugleich für notwendig hält. Prekär, weil immer neu auffüllungsbedürftig und strittig. Notwendig, weil praktisch unverzichtbar.
Unverzichtbar in einem instrumentellen Sinn?
Ja, in dem Sinne, dass Wahrheit ein Mittel zum Zweck ist, Freiheit in sinnvoller Form auszuüben. Die Wahrheit von Tatsachenaussagen liefert uns eine richtige Beschreibung dessen, was wir tun können oder nicht, was wir oder andere wollen.
Brauchen wir Wahrheit also, um Freiheit wahrnehmen zu können?
Eine gute Pointe liberaler Theorien ist, dass sie Vergemeinschaftung erst mal sehr kognitiv denken. Etwa David Humes Begriff der »Konvention«. Dass wir sagen: Bevor wir von gemeinsamen Werten oder Überzeugungen reden, fangen wir doch erst mal an mit gemeinsamen Wahrnehmungen. Mit Luhmann: Oh, da ist die Tür, da gehen wir alle raus – dann haben wir schon mal ein kollektives Handlungsproblem gelöst! Und da spielt der Wahrheitsbegriff noch mal eine schärfere Rolle als bei normativen Aussagen, weil die Wahrheitsfähigkeit normativer Aussagen noch umstrittener ist als jene beschreibender Aussagen. Erst mal geht es um eine geteilte Weltbeschreibung unter der Bedingung ihrer permanenten Umstrittenheit.
Gibt es Wahrheiten, die zu einem bestimmten Handeln »nötigen« – oder ist der Begriff falsch gewählt?
Ich finde den Begriff gar nicht so schlecht, wenn er so etwas bedeutet wie: in eine Richtung drängen, aber nicht determinieren. Es gibt kein naturwissenschaftliches Faktum, keine Tatsachenbeschreibung, die als solche zu einer bestimmten Politik führt. Umgekehrt ist Politik als Ausdruck von Freiheit immer auch ein Mittel, um sich mit Fakten nicht abzufinden, sondern es trotzdem anders zu machen. Kein noch so harter Kausalzusammenhang führt von selbst zu einer Politik, und trotzdem gibt es immer wieder doch einen Zustand der Welt, der bestimmte Optionen näherlegt als andere – und der sich manchmal auch einfach Bahn bricht. Und wenn das überfüllte Intensivstationen sind. Es gibt immer tausendfache Vermittlungen, aber irgendwann sind diese Vermittlungen auch an einen Punkt gekommen, an dem manches eher passieren wird als anderes. Egal was die politische Willensbildung möchte.
Die Politik steht also vor der paradoxen Aufgabe, sich von der Notwendigkeit nicht nötigen zu lassen…
Die Frage ist, wie man Notwendigkeit ausdefiniert. Es ist immer wieder ein politischer Anspruch, Kausalzusammenhänge zu politisieren, also zu sagen, das ist gar kein Kausalzusammenhang, sondern hat etwas damit zu tun, was wir wollen. Von Franklin Roosevelt stammt die Feststellung, dass die Gesetze der Ökonomie keine Gesetze der Natur, sondern menschengemachte Gesetze sind. Stimmt das? Schwierige Frage. Aber zunächst mal ist das ein genuin liberaler Ansatz, weil er erst mal sagt: Wir gestalten die Welt. Aber dann kommt irgendwann eine faktische Wahrheit, die das an die Grenze bringen wird.
In der Politik wird aber auch über Fakten gestritten, nicht nur über normative Fragen.
Das ist sogar typisch für politische Auseinandersetzungen. Die Politik ist ein handlungsorientiertes Format, im Unterschied zur Philosophie, und dazu gehört, dass man am Ende über diese Handlungen streitet, und damit immer auch über Fakten. Es gibt keinen Streit, etwa zwischen Sozialisten und Konservativen, der nur über Normen wäre und nicht am Ende auch über Fakten. Ideologische Auseinandersetzungen sind immer auch ein Streit über Zustandsbeschreibungen der Welt, also über deskriptive Aussagen. Das ist natürlich unbefriedigend, andererseits entspannt es auch ein bisschen mit Blick auf die Fake-News-Debatte oder die Hysterie darüber, dass wir keine gemeinsame Wahrheit teilen. Darin steckt zwar ein massives Problem, aber zugleich ist es auch die Normalität von Politik, dass wir nie unbestrittene Fakten haben.
Hat Ideologie also einen Platz in der Politik?
Ja, weil wir die Vermittlung von politischen Prinzipien und politischem Handeln ohne sie nicht ausdefiniert bekommen. Um kollektives Handeln möglich zu machen, brauchen wir Ideologien, die politische Präferenzen zusammenfassen und zu einem gewissen Grad zu systematisieren versuchen. Das heißt aber auch, über Sachverhalte zu streiten, nicht nur über Weltanschauung.
Brauchen wir politische Ideologien, um Komplexität zu reduzieren?
Die Gegenprobe wäre ja der Anspruch, alle Probleme rein sachlich zu lösen. Da hätten wir zwei Probleme. Erstens wäre die Sachbeschreibung natürlich trotzdem umstritten. Zweitens, selbst wenn die Sachbeschreibung nicht umstritten wäre, hätten wir abweichende Interessen, wie wir mit den Sachverhalten umgehen. Um diese beiden Probleme zu lösen, kommen wir zu politischen Ideologien.
Der etablierte Bestand der liberalen Demokratie muss jetzt noch mal mit Blick darauf infrage gestellt werden, wie viel politische Ungleichheit sich in ihr verbirgt.
Worin besteht für Sie der Zusammenhang zwischen Liberalismus und Demokratie?
Man muss sich zunächst klarmachen, dass der Zusammenhang nicht selbstverständlich ist, das ist er erst nach dem Zweiten Weltkrieg geworden. Wir sehen heute, dass er wieder auseinanderfällt – dass Leute von Demokratie ohne Liberalismus reden. Zugleich müssen wir aber auch über das Verhältnis von Liberalismus und Kapitalismus nachdenken und darüber, ob es so etwas gibt wie eine liberale Kapitalismuskritik. Ich würde immer noch sagen, dass das Versprechen des Liberalismus, Menschen unter Bedingungen einer gewissen fairen Chancengleichheit bestimmte Möglichkeiten zu geben, ihr Leben zu gestalten, unter demokratischen Bedingungen gut aufgehoben ist. Aber ich würde auch denken, dass der Liberalismus auf dem Weg zur Demokratie viel kritischer als bisher über Wirtschaft und Verteilung nachdenken muss. Insofern ist das ein langer Weg, vielleicht einer von rechts nach links. Es ist richtig, Demokratie und Liberalismus nur zusammen zu denken. Aber der etablierte Bestand der liberalen Demokratie muss jetzt noch mal mit Blick darauf infrage gestellt werden, wie viel politische Ungleichheit sich in ihr verbirgt.
Welche Freiheiten sind Ihnen persönlich besonders wichtig – und welche Einschränkungen haben Sie in letzter Zeit besonders alarmiert?
Persönlich ist die Selbstgestaltung von Themen und Zeit für mich elementar. Wenn mir eine Organisation das nicht mehr ermöglicht, werde ich unruhig. Politisch beunruhigt hat mich gar nicht so sehr eine bestimmte Freiheitseinschränkung – sondern eher die Selbstverständlichkeit, mit der sich Freiheitsgegner, obwohl sie aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten kamen, als Gefährten und Anhänger eines gemeinsamen politischen Projekts gefunden haben. Dass Leute, die so unterschiedlich sind wie Trump, Erdogan, Orbán oder Putin, politisch so zueinandergefunden haben, dass sie sich schätzen. Dass es so etwas gibt wie eine Internationale der Unfreiheit.
Dieses Interview erschien in dem Sonderheft HOHE LUFT kompakt »Metanoia 2.0«