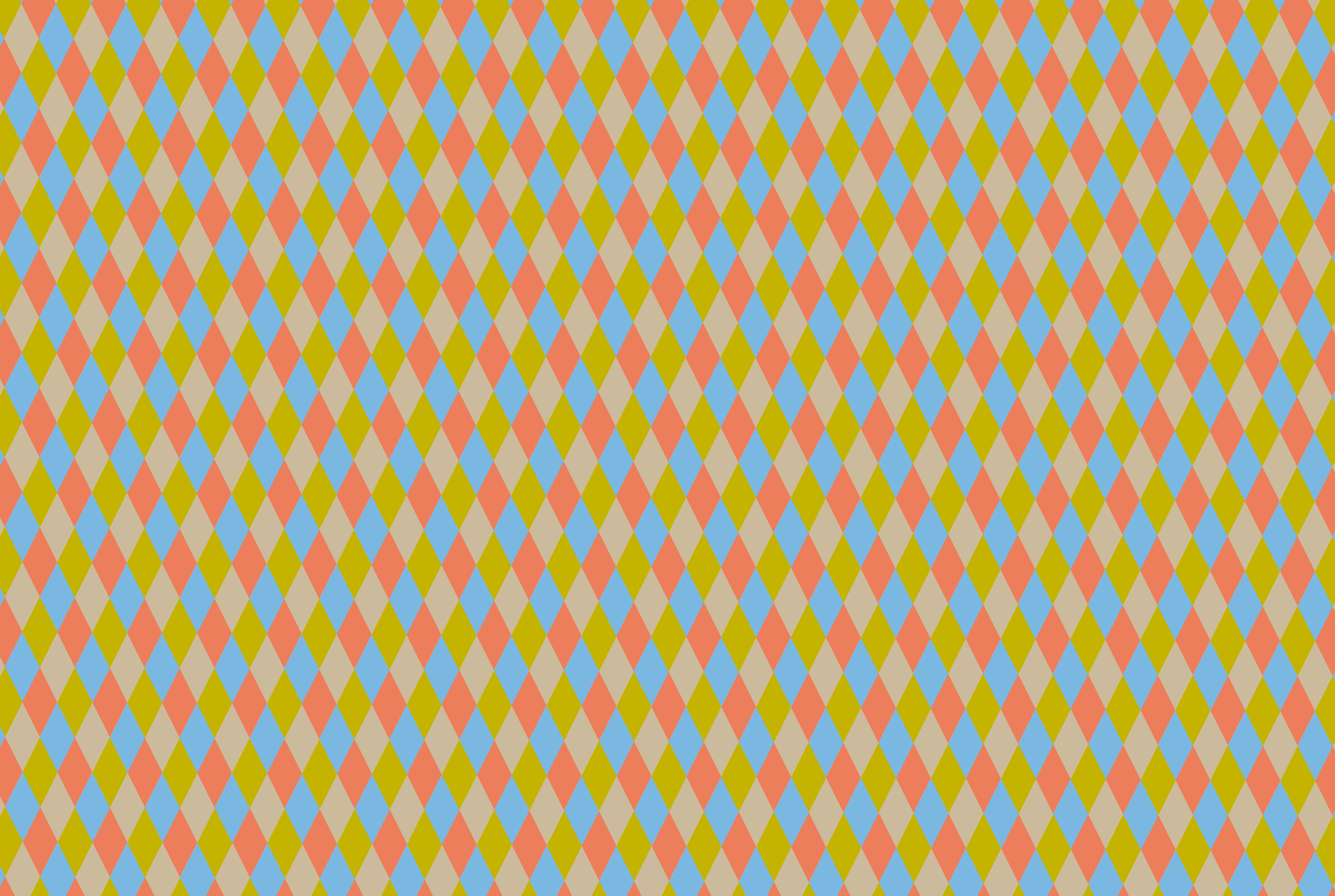Das Thema Schwangerschaft kommt in der Philosophie so gut wie gar nicht vor. Dabei gibt es allen Anlass dazu, diesen besonderen Zustand philosophisch zu betrachten. Schließlich geht es um die Schöpfung neuen Lebens, um das Entstehen von etwas zuvor nicht in der Welt Gewesenem.
Text: Greta Lührs
Als ich es das erste Mal spüre, sitze ich am Tisch und lese. Da ist ein leichtes Zucken in meinem Bauch, das sich ganz anders anfühlt als bisher bekannte Regungen aus meinem Inneren. Ich erschrecke ein wenig und halte gespannt den Atem an, versuche, dem Gefühl nachzugehen und es zu lokalisieren. Da ist es wieder. Ich lege eine Hand an den Bauch. Wüsste ich nicht, dass es sich dabei um die Bewegungen eines werdenden Menschen handelt, würde ich mir Sorgen machen. Aber so muss ich unwillkürlich selig lächeln. »Hallo«, sage ich in Gedanken. Da ist ja wirklich jemand.
Schwangersein ist ein Zustand, den man sich schwer vorstellen kann, wenn man ihn nicht selbst erlebt hat und der selbst für die Schwangere oft unbegreiflich und wundersam bleibt. Die einen glorifizieren ihn als einmaliges Erlebnis der natürlichsten Form von Weiblichkeit, andere vergleichen ihn mit einem Parasitenbefall und sehen in ihm den Anfang vom Ende des selbstbestimmten Lebens. Für mich ist die Schwangerschaft auch aus philosophischer Perspektive interessant: zum Beispiel deshalb, weil sie die Schwangere mit voller Wucht aus der geistig-kulturellen Sphäre auf den Boden des Organischen befördert. Und während mein Körper sich der Aufgabe verschreibt, neues Leben zu erschaffen, schwirren mir zugleich viele Fragen, Gedanken und Ängste durch den Kopf. Auf einmal befinde ich mich inmitten des uralten Kreislaufes von Leben und Tod, an der Quelle einer neuen Existenz, der ich ins Dasein verhelfe und aus der ein selbstständiger Mensch werden wird – mit eigenen Ideen und Träumen, einer Biografie und einem Personalausweis.
Die Entscheidung für ein Kind zieht vermutlich so radikale Veränderungen nach sich wie sonst kaum eine. Was bedeutet es für mich, dass in mir etwas Lebendiges heranwächst? Ab wann ist ein Mensch überhaupt ein Mensch? Darf ich ungefragt ein Kind in diese (nicht nur gute) Welt setzen? Warum möchte ich überhaupt eines? Bin ich dafür bereit – mental, menschlich, ökonomisch? Ist es egoistisch, sich fortzupflanzen, obwohl es schon mehr als genug Menschen und Kinder auf dieser Welt gibt? Was macht es mit einem, die eigenen Bedürfnisse hinter jene eines Neugeborenen zu stellen? Was bedeuten Schwanger- und Elternschaft für ein Paar? Was, wenn ich es bereue?
Plötzlich ist man nicht mehr allein in seinem Körper
Obwohl die Schwangerschaft so viele existenzielle Fragen berührt und sie am Anfang jedes Lebens steht, ist das Thema in der Philosophie unterrepräsentiert. Einerseits mag das daran liegen, dass Philosophie lange Zeit ausschließlich von Männern betrieben wurde. Diese klassisch männlich geprägte Philosophie tendierte dazu, das Geistige als dem Körperlichen überlegen anzusehen und sich darum auf die Theorie des Ersteren zu fokussieren. Man kümmerte sich lieber um den bereits denkenden Menschen als um dessen Entstehung. Traditionell galt die geistig-kulturelle Sphäre zudem als männliches Hoheitsgebiet, während das Weibliche dem körperlich-natürlichen Bereich zugerechnet wurde. Eine Denkströmung, die sich ausnahmsweise ganz intensiv um den Menschen als leibliches Wesen rankt, ist die Phänomenologie, insbesondere die Leibphänomenologie.
Einer ihrer wichtigsten Vertreter ist der französische Philosoph Maurice Merleau-Ponty (1908–1961). Er betonte die Rolle des Leibes als unser Zuhause, als das, was uns zu aktiven Teilnehmer*innen in dieser Welt macht und uns über die beobachtende Rolle erhebt. Als Körper sind wir immer schon ins Geschehen eingebunden. Erst durch ihn können wir denken, wahrnehmen, handeln, leben. Statt die Welt in Geist und Materie aufzuteilen, geht es nach Merleau-Ponty darum, dass wir uns sowohl als körperliche als auch als geistige Wesen begreifen.
Obwohl sich Merleau-Ponty auch mit dem leiblichen Geschlechtstrieb befasste, spielt die Geschlechterdifferenz für seine Leibphänomenologie jedoch keine Rolle. Erst die französische Philosophin und Schriftstellerin Simone de Beauvoir (1908–1986), die mit Merleau-Ponty bekannt war, beschreibt in ihrem feministischen Hauptwerk »Das andere Geschlecht« von 1949 die »gelebte Erfahrung« der Frau und geht ausdrücklich auf Schwanger- und Mutterschaft ein.
Neun Monate sind in Relation zu einem Menschenleben kurz. Man könnte die Schwangerschaft also »nur« als Durchgangsstadium zwischen Befruchtung und Geburt betrachten. Dabei ist sie gerade in phänomenologischer Hinsicht auch als Zustand an sich spannend, weil sie die eigene Leiberfahrung grundlegend auf den Kopf stellen kann. Plötzlich ist man nicht mehr allein in seinem Körper. Das, was am vertrautesten ist, fühlt sich auf einmal ganz anders an, fast ein wenig entfremdet. Es passieren unbekannte Dinge mit mir, alles wächst und dehnt sich, in mir zieht und zappelt es, andauernd muss ich meinen körperlichen Zustand medizinisch überwachen lassen. Bevor die Verantwortung als Mutter mich einholt, spüre ich ihre Vorzeichen am eigenen Leib. Einige Spuren dieser Zeit werden für immer bleiben.
Wie Simone de Beauvoir haben sich die meisten Denkerinnen dem Themenbereich Schwanger- und Mutterschaft im Rahmen einer feministischen Philosophie angenähert und sich dabei vor allem darum bemüht, die Frau von ihrer Festlegung auf die Mutterrolle zu befreien. Beauvoir beschreibt, wie die Angst vor einer Schwangerschaft das Liebesleben von Frauen beeinträchtigte. Bis Verhütungsmittel allgemein zugänglich wurden, war jeder Sex mit dem Risiko verbunden, ungewollt schwanger zu werden, und zu Beauvoirs Zeiten war nicht nur die Abtreibung noch stärker kriminalisiert als heute, sondern auch die gesellschaftliche Ächtung unverheirateter Mütter so vehement, dass eine Schwangerschaft oft den Ruin bedeutete. »Die Geburtenkontrolle und die legale Abtreibung«, so Beauvoir, »gäben der Frau die Möglichkeit, ihre Mutterschaft frei anzunehmen.«
Ein Baby stellt die Gleichberechtigung auf die Probe
Ganz so weit sind wir zwar bis heute, jedenfalls in Deutschland, nicht – noch immer meinen einige konservative Kräfte, darunter viele Männer, man dürfe Frauen das Recht absprechen, selbst über ihren Körper zu bestimmen. Doch immerhin duldet die Gesellschaft heute uneheliche Kinder, Alleinerziehende, Patchwork- und Regenbogenfamilien. Sex und Schwangerschaft sind nicht mehr zwingend miteinander verbunden – dank Verhütungsmitteln und Reproduktionsmedizin kann man beides auch ohne das andere haben.
Für Simone de Beauvoir sind Schwanger- und Mutterschaft damit verbunden, dass die Frau ihre Autonomie aufgeben muss. Beauvoir äußert sich zum Teil sogar abfällig über den »Parasiten«, der von dem Körper der Frau zehre, während dieser weich und rund würde, um seinen Dienst an der Natur zu erfüllen. Die Philosophin und Schriftstellerin hatte selbst keine Kinder. Einige Feministinnen warfen ihr vor, die Mutterschaft zu einseitig negativ zu bewerten. Und doch muss es Beauvoir und ihren Mitstreiterinnen hoch angerechnet werden, dass wir heute offener als je zuvor auch über die Schattenseiten von Mutter- und Schwangerschaft sprechen können.
Es gibt nämlich auch die Gegenstimmen zu Beauvoir, die die Gebärfähigkeit der Frauen als ihre natürliche Superkraft verklären. Bilder der Frau als Quelle des Lebens, als Urmutter, als Fruchtbarkeitsgöttin legen weiblichen Personen nahe, erst dann als Frau richtig komplett zu sein, wenn sie ein Kind gebären. Vor Kurzem veröffentlichte die Lehrerin und Autorin Verena Brunschweiger ein Manifest, in dem sie fordert, statt von »kinderlosen« Frauen sollte man von »kinderfreien« sprechen – um darauf aufmerksam zu machen, dass sich Frauen selbstbestimmt gegen Kinder entscheiden dürfen und dass das kein Makel ist.
Für den feministischen Diskurs bleibt Mutter- und Schwangerschaft weiterhin ein wichtiges Thema, da viele der heutigen Ungleichheiten unter den Geschlechtern es auf die ein oder andere Art berühren: Frauen erledigen nach wie vor den größten Teil der »Care«-Arbeit, etwa die Kindererziehung oder das Kümmern um andere Familienangehörige, weil sie als das fürsorgliche, eben mütterliche Geschlecht gelten. Sie sind stärker von Altersarmut bedroht als Männer, verdienen durchschnittlich weniger, was nicht zuletzt mit schwangerschaftsbedingten Ausfallzeiten zusammenhängt.
Man erlebt und liest es auch heute immer wieder, dass Paare, die eine gleichberechtigte Beziehung führen und dies auch als Ideal betrachten, durch die Entscheidung für ein Kind in alte Geschlechterrollen zurückfallen. Dann bleibt eben doch die Frau zu Hause und kümmert sich um das Baby, weil der Mann einfach mehr verdient – »es wäre doch irrational, es anders zu handhaben!« Es kann eben nur die Mutter stillen, »dann kann der Vater auch in Ruhe zum Sport gehen oder arbeiten«. Muss der werdende Papa unbedingt mit zum Arzt? Er hat schließlich nicht das Gefühl, die Kontrolle über seinen Körper zu verlieren. Er muss auch nicht penibel auf Alkohol verzichten und jedes Gemüse doppelt und dreifach abwaschen. An der Tatsache, dass es einen Mann – zumindest biologisch zwingend – nur für den Beginn der Schwangerschaft braucht, hat sich auch nach Jahrzehnten des Geschlechterkampfes nichts geändert. Ein Kind kann zur Welt kommen, ohne dass sein Erzeuger auch nur davon weiß. Einer Mutter kann das nicht passieren.
Nie habe ich mich so »in den Fängen der Natur« (Beauvoir) gefühlt wie als Schwangere. Im Gegensatz zu meinem Partner bin ich jede wache Minute, und zusätzlich auch nicht selten in meinen Träumen, damit konfrontiert, dass in mir ein Mensch heranwächst.
Schwangerschaft braucht Mut
Wir sind es gewohnt, die Kontrolle über unser Leben und unseren Körper zu haben – zumindest in einem gewissen Maße. In Bezug auf eine Schwangerschaft haben wir es inzwischen einigermaßen in der Hand, sie zu verhindern. Doch sobald es um den Kinderwunsch geht, sind wir der Kontingenz der Natur ausgeliefert. Zwar arbeitet die Reproduktionsmedizin dagegen an, doch ob eine Frau schwanger wird und ein Kind bekommt und ob dieses Kind auch gesund ist, unterliegt immer noch Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Gerade der Beginn einer Schwangerschaft ist so sehr von Unsicherheit und hoffnungsvollem Bangen geprägt, dass man beinahe die Nerven verliert. Die ersten drei Monate behält man es ganz selbstverständlich noch für sich, ermahnt sich, sich nicht zu sehr zu freuen, schließlich ist der kleine Lebenskeim noch sehr fragil und jede dritte Schwangerschaft endet nicht mit einem Baby.
Die Schwangere braucht eine gehörige Portion Mut, denn sie begibt sich in eine Situation großer Verletzlichkeit. Sie muss darauf vertrauen, dass ihr Körper den neuen Menschen ohne ihr aktives Zutun zusammenbaut, während sie ihrem Alltag nachgeht. Trotzdem kann sie nicht anders, als sich verantwortlich zu fühlen für das, was in ihr vorgeht. Viele Frauen geben sich selbst die Schuld für eine Fehlgeburt, selbst wenn es keinerlei Anzeichen dafür gibt, dass sie sich falsch verhalten hätten. Obwohl die Schwangerschaft erst später auch körperlich richtig anstrengend wird, ist die psychische Belastung rund um den Kinderwunsch und die Schwangerschaft immens. Immer wieder beschleicht mich der Gedanke: Man muss eigentlich völlig wahnsinnig sein, um sich auf so etwas Vages, Zerbrechliches und dabei so Gefühlsintensives einzulassen.
Wirtin und Schöpferin zugleich
Mit ihren ganzen Unwägbarkeiten und Sachzwängen passt eine Schwangerschaft auf eine Art gar nicht mehr in unsere technologisierte Zeit. Der aufgeblähte Körper, die blutige Geburt, das Stillen des Säuglings an der Brust – nichts erinnert so sehr daran, dass wir auch nur Tiere sind, die mit Smartphones durch die Stadt laufen. Frauen bekommen heute später Kinder als noch vor einigen Jahren, weil sie ihre Zwanziger genießen möchten, Karriere machen wollen oder weil es sich eben so ergibt. Doch an den medizinischen Empfehlungen, wann der beste Zeitpunkt für ein Kind sei, ändert sich nichts. Homosexuelle Paare müssen sich entweder eine Samenspende organisieren oder gar jemanden finden, der ein Kind für sie austrägt – wobei Leihmutterschaft und Eizellenspenden in Deutschland nicht erlaubt sind. Die Natur hinkt ganz schön hinter dem gesellschaftlichen Wandel her. Während mein Bauch anschwillt und es immer anstrengender wird, meine Schuhe anzuziehen, wünsche ich mir manchmal, wir wären den Pinguinen näher: Ein Ei kann auch vom Vater ausgebrütet werden.
So aber bleibt es meine Aufgabe; ich habe als Frau die Macht über das Gebären mitgeliefert bekommen. Die leibliche Verbundenheit mit dem Fötus empfinden einige Schwangere als Last, andere als einzigartige Erfahrung, die sie nicht abgeben wollen würden, und wieder andere als ein bisschen was von beidem. Für mich ist das Gefühl ambivalent: Zwar stelle ich meinen Körper dem Fötus zur Verfügung, richte meine Lebensweise auf diesen neuen Zustand ein, doch bringe ich dadurch auch einen neuen Menschen in die Welt. Ich bin Wirtin und Schöpferin zugleich.
Frauen bekommen das Gefühl, es nur falsch machen zu können
Dass Frauen Kinder gebären können, wurde und wird immer wieder auch gegen sie verwendet. Die Allmacht der Leben spendenden Urmutter wird dann gleichsam zum Los, das ihr ganzes Dasein bestimmt. Simone de Beauvoir beschreibt die Frau als »zur Immanenz verurteilt«: Sie bleibe aus der Sphäre der Transzendenz ausgeschlossen. Selbst in dem Moment, wo sie ihr eigenes Dasein mittels der Schwangerschaft gewissermaßen transzendiere, weil in ihr etwas Neues entstehe, das größer ist als sie selbst, werde sie gleichsam nur noch mehr Fleisch, Körper, Immanenz.
Philosophen wie Friedrich Nietzsche (1844–1900) oder Arthur Schopenhauer (1788–1860) betrachteten Frauen gar als zum Denken untauglich. Doch selbst Beauvoir schien zu glauben, dass eine Mutterschaft ihrem intellektuellen Wirken eher geschadet hätte. Und ich glaube, es ist auch heute noch die Angst vieler Frauen, intellektuell zu verkümmern, wenn sie sich nur noch mit »Babykram« auseinandersetzen. Davon berichtet auch die Philosophin Svenja Flaßpöhler in ihrem Buch »Zur Welt kommen«: Als Schwangere liest sie Nietzsche und sagt sich: »Ich möchte nicht wählen zwischen geistiger und körperlicher Fortpflanzung.«
Während der Schwangerschaft entwickeln meine Emotionen tatsächlich ein Eigenleben. Von kribbelnder Euphorie bis hin zu bodenloser Verzweiflung ist alles dabei. Aber als Beweis dafür, dass (schwangere) Frauen nicht denken könnten, kann ich das nicht gelten lassen. Ich meine vielmehr, dass wir heute darüber hinweg sein sollten, Vernunft und Gefühl gegeneinander auszuspielen, als seien sie nicht beide Teil des Menschseins. Ein wenig Irrationalität gehört bei einem Unterfangen von so existenzieller Bedeutung wie einer Schwangerschaft einfach dazu. Würde man nur rationale Erwägungen zurate ziehen, würde man sich gar nicht erst dem Stress aussetzen, ein Kind zu bekommen.
Man weiß zwar heute, dass auch eine Mutter Philosophin sein kann, doch nach wie vor entstehen Frauen mit der Entscheidung für ein Kind mehr Nachteile als Männern. Den berufstätigen Mann fragt man selten, wie er Job und Erziehung unter einen Hut bekommen will. Während die moderne Frau sowieso unter dem Erwartungsdruck steht, gleichzeitig schön und schlau, stark und sensibel, erfolgreich und fürsorglich, sexy und liebevoll zu sein, so wird dieser Druck in Bezug auf die Mutterschaft noch verstärkt.
Bekommt eine Frau keine Kinder, heißt es noch heute nicht selten, sie habe wohl keinen abbekommen und werde als verbitterte Katzenfrau enden, bekommt sie welche, verzichtet sie freiwillig auf Karriere und wählt das tumbe Muttileben. Gibt sie das Kind früh in die Betreuung, um zu arbeiten, ist sie herzlos und karrieregeil, bleibt sie länger zu Hause, ist sie das Heimchen am Herd, das nicht loslassen kann. Das große Versprechen, eine Frau könne heute alles haben, offenbart sich als das schale Gefühl, es eigentlich nur falsch machen zu können.
Bin ich wirklich bald Mutter?
Ein großer Teil dieses Problems liegt darin, dass Kinderkriegen als Frauenthema gesehen wird – nicht als das, was es eigentlich ist: ein Familienthema, ein Gesellschaftsthema. »Du bist eben als Mann nicht schwanger«, sagt auch mein Partner. Doch auch Männer werden Väter, und das Austragen ist nicht alles. Es gibt genügend Möglichkeiten, als Vater oder andere Person präsent zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Das muss man nur wollen und aktiv etwas dafür tun. Es reicht dabei nicht, als Vater zwei Monate Elternzeit zu nehmen und womöglich die altbackene Ansage seines Arbeitgebers zu akzeptieren, dass ein Mann, der mehr Elternzeit nähme, sich damit ins Abseits befördere.
Durch die vielen Gedanken in meinem Kopf und die ganzen Termine fällt es mir manchmal schwer, die Zeit der Schwangerschaft einfach nur zu genießen. So vieles will organisiert, besprochen, geplant werden. Die körperlichen Strapazen eröffnen mir aber auch eine bereichernde Perspektive auf meinen Körper: Ich kann mich nicht nur selbst durchs Leben tragen, ich kann etwas Einzigartiges hervorbringen. Mit dem wachsenden Bauch nähere ich mich langsam einer Sphäre, die mir bislang völlig fremd war. Bald bin ich Mutter, obwohl ich mich in diesem Wort noch gar nicht selbst sehen kann. Ich werde dadurch eine neue Welt kennenlernen – ohne vorher zu wissen, wie sie mir gefällt –, aber wahrscheinlich auch eine andere verlieren. So unbeschwert wie ohne Kind wird mein Leben vermutlich nie wieder sein.
Die bevorstehende Geburt ist zwar der ultimative Anfang aber zugleich auch ein Ende: das Ende der Einheit von Frau und Fötus, das Ende vom Alltag als Paar. Dass wir sterben müssen, ist eine Grundvoraussetzung des menschlichen Lebens. Eine andere ist es, geboren worden zu sein. Dieser Facette der Conditio humana räumte die Theoretikerin Hannah Arendt (1906–1975) einen besonderen Stellenwert ein.
Alle menschlichen Tätigkeiten, so Arendt, sind an der Natalität (Geburtlichkeit) orientiert, denn sie verweisen auf eine Zukunft, in der immer wieder neue Erdenbewohner*innen hinzukommen und weitermachen. »Der Neubeginn, der mit jeder Geburt in die Welt kommt«, schreibt Arendt, »kann sich in der Welt nur darum zur Geltung bringen, weil dem Neuankömmling die Fähigkeit zukommt, selbst einen neuen Anfang zu machen, d. h. zu handeln.« In mir entsteht gerade ein neuer Anfang, der selbst viele neue Anfänge bewirken wird. Für mich ist das der Inbegriff von Hoffnung.
Dieser Artikel erschien zuerst in HOHE LUFT 5/2019