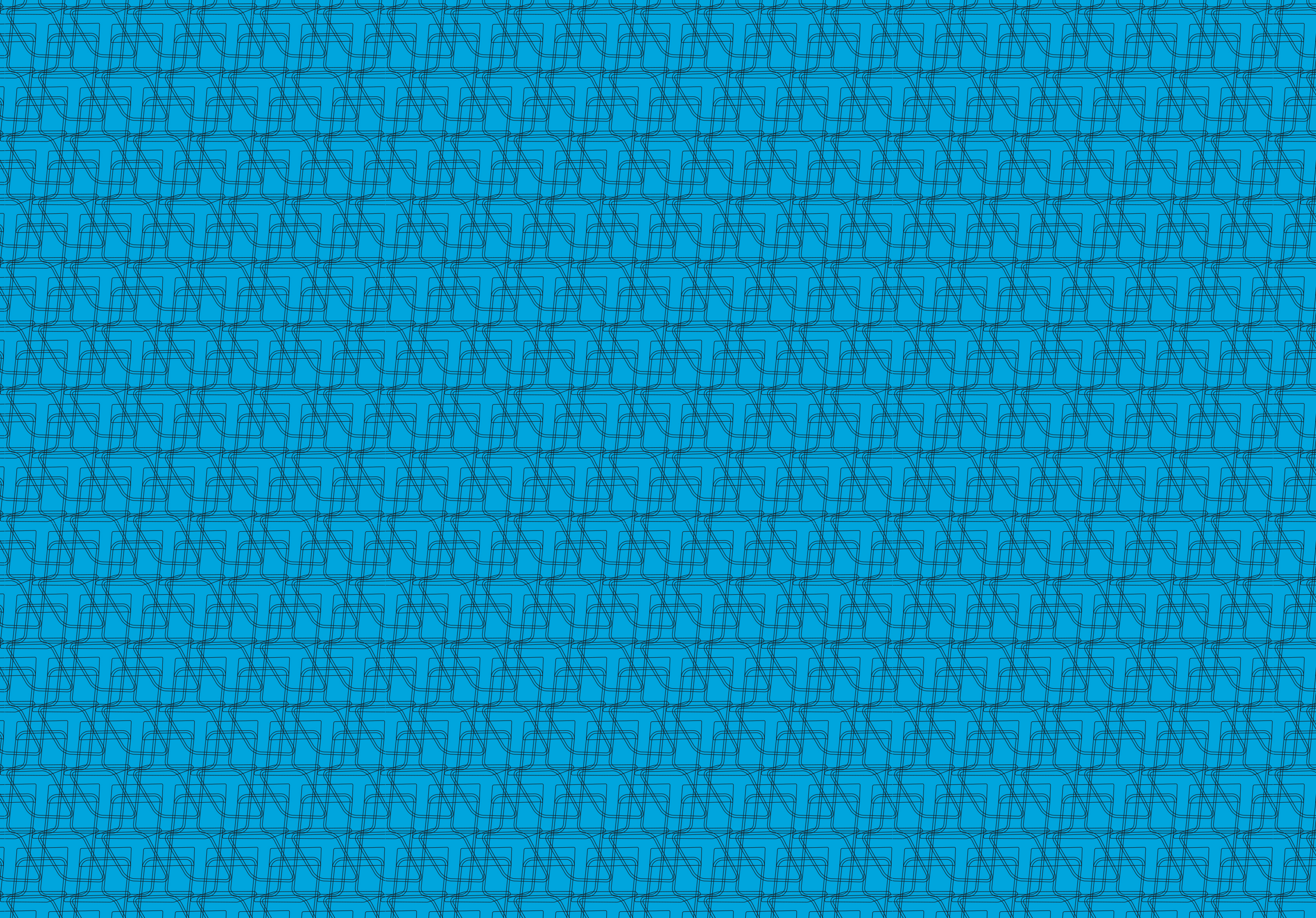Es war schon vorher da, aber so richtig fing es mit einer Konzertabsage an. Am Freitag, dem 13. wurde ein Konzert abgesagt, das ich am Samstag eine Woche später besucht hätte. Samstags drauf hätte ich an einem Literaturfestival gearbeitet. Auch das wurde abgesagt. Am Sonntag habe ich Bücher aus der Bibliothek der Universität Konstanz geholt. Einen Tag später wäre mir das kaum mehr möglich gewesen. Es wurde auf Notbetrieb umgestellt. Ein weiteres Hindernis hätte sich dazwischen gestellt. Als Schweizer Staatsbürger, wohnhaft in Kreuzlingen, hätte ich die Grenze nach Konstanz nicht mehr einfach so passieren können. In allerkürzester Zeit ist eigentlich alles anders geworden.
So erging es wohl allen. Wir mussten unser Leben einem Virus anpassen. Dessen unsichtbare Anwesenheit ist überall spürbar. Unsere Lebens- und Gedankenführung haben wir ihm vollständig unterordnen müssen. Folglich ist es sowohl um die Kausalität wie auch um das Kräfteverhältnis eher umgekehrt bestellt: Das Virus hat unser Leben an sich angepasst. Aktuell befindet sich eine doch recht weit vorangeschrittene Gesellschaft in Geiselhaft eines krankmachenden, im schlimmsten Fall tödlichen Virus. Wie konnte das passieren? In seiner ausführlichen Medizingeschichte „Die Kunst des Heilens“ weist Roy Porter daraufhin, dass die Erwartung eines endgültigen Sieges über die Krankheit immer naiv wirken muss, widerspricht sie doch dem entscheidenden Axiom der darwinistischen Biologie: der unaufhörlichen evolutionären Adaption. Genau dies vollbringt die Krankheit weitaus besser als der Mensch.[1]
Es handelt sich demnach um ein wechselseitiges Verhältnis: Der Mensch mutiert mit seinen Krankheiten, so wie diese mit ihm mutiert. Dabei ist die Krankheit immer einen Schritt voraus. Denn erfasst sie den Menschen, zwingt sie ihn, Heilmittel gegen sich zu entwickeln. Auf welchen Wegen und Irrwegen das geschehen ist, wie man also zu diesbezüglichen Erkenntnissen gekommen ist, und welche Hindernisse sich deren Durchsetzung entgegengestellt haben, beschreibt Stefan Winkles Kulturgeschichte der Seuchen, die „Geißeln der Menschheit“, auf über 1500 eng bedruckten Seiten. Als Beispiel dafür, wie die mit – und gegen – uns mutierenden Krankheiten „dazulernen“, sei das Immunschwäche-Virus HIV genannt: Es besitzt „Insider“-Kenntnisse über die komplexen Zusammenhänge der menschlichen Immunabwehr, greift es sie doch gezielt an ihren verletzlichsten Punkten an.[2] Ohne das wirklich zu wollen, waren wir selbst es, die das Virus mit diesem Wissen über uns ausgestattet haben.
Allein weil wir eigentlich gar nicht anders können, als gegen eine uns bedrohende Krankheit anzukämpfen, hat diese, insofern sie uns in einer Weise erfasst, wie es Covid 19 nun tut, den Kampf auch schon gewonnen. Wie auch immer wir reagieren, sie ist es, die a priori über diese zwangsläufig a posteriori erfolgende Reaktion verfügt. Wenn man das Virus gewähren lässt, riskiert man eine Infektionsrate mit unabsehbaren Folgen, wenn man versucht, es einzudämmen, befindet man sich insofern vollauf in dessen Gewalt, als man Teil einer Gesellschaft wird, deren oberste Priorität in der Virusbekämpfung liegt.
Wir sehen uns gerade einem rigiden „Corona-Regime“ unterworfen. Sämtliche Lebensbereiche unterstehen einem Virus, es steht am Grund (fast?) aller unserer Handlungen. Da diese sich ausnahmslos auf es beziehen müssen, erleben wir eine noch vor Kurzem kaum für möglich gehaltene Vereinheitlichung unseres sozialen Lebens. Dem Virus kommt aktuell ein quasi-göttlicher Status zu. Selbst in seinen besten Tagen hat Gott selten eine solche Machtfülle auf sich vereint. In noch einer Hinsicht gleichen sich Gott und das Corona-Virus. Sie üben ihre Macht nicht selbst aus, sondern durch ihre menschlichen(-allzumenschlichen) Repräsentanten. Einer davon ist der allgegenwärtige Virologie Christian Dorsten, der seinerseits darauf verweist, dass die Repräsentanten, die schließlich die Entscheidungen treffen, die Politiker sind. Diese haben restriktive Maßnahmen verfügt.
Dafür liegen sehr gute Gründe vor. Dennoch sind die Entscheidungen, die zu ihnen geführt haben, das sagt auch Drosten, nicht rein evidenzbasiert. Ihnen haftet, um es äußert vorsichtig zu formulieren, zumindest ein nicht gänzlich verifizierbarer Rest an. Zu gewissen Handlungen bzw. Unterlassungen – das sogenannte „social distancing“ ist eher unterlassend – wird man folglich gezwungen. Das wirft unvermeidlich die Frage auf, ob die spürbaren Wirkungen, also diese Maßnahmen, von ihrer Ursache her, die Gefährlichkeit des Virus‘, gerechtfertigt werden können. Vielleicht wird man in ein paar Monaten mit einiger Berechtigung behaupten: Es war das Beste, das wir tun konnten. Es besteht aber zumindest die Möglichkeit, dass man eingestehen muss, wie übertrieben das war, oder, auch das ist noch möglich: wie unter-trieben. Aktuell handeln wir auf Zeitgewinn hin. Wir geben einen Vorschuss, von dem höchst unsicher ist, ob und in welcher Form wir ihn zurückerhalten.
Uns ist etwas überaus Heikles abverlangt: Wir müssen Handlungen vornehmen, für die gute Gründe vorliegen, von denen wir aber nicht mit letzter Sicherheit sagen können, ob sie von ihrem Grund her gänzlich gerechtfertigt sind. Etwas Gewisses steht damit etwas eher Ungewissem gegenüber: Es ist sicher, dass wir in von uns verlangter Form handeln müssen, es ist nicht ganz sicher, ob das so richtig ist. Wir sehen uns vor Entscheidungen gestellt, die für uns schon getroffen worden sind und es bleibt uns nicht viel anderes übrig, als das auszuführen, was sie uns abfordern. Das gilt auch für jene unter uns, die diesen Maßnahmen eine gehörige Portion Skepsis entgegenbringen. Wenngleich ein gewisser Konsens bezüglich der getroffenen Maßnahmen zu beobachten ist, herrscht unter Experten durchaus keine Einigkeit. Wir müssen also den entscheidungsbefugten Experten vertrauen. Da Vertrauen unabschließbar ist und notwendig einen Rest an Misstrauen übrig lässt, müssen wir die aktuellen Maßnahmen zu einem gewissen Teil quasi-religiös glauben – oder zumindest so tun, als ob wir sie glauben würden. Man muss ihnen ein Vertrauen entgegenbringen, über das man noch gar nicht verfügen kann.
So greift das „Thomas-Theorem“ hier. Es besagt, dass Situationen, die von Menschen als wirklich definiert werden, in ihren Konsequenzen tatsächlich wirklich werden.[3] In dem vorliegenden Fall bedeutet das, dass die Handlungen, die auf der Grundlage der Gefährlichkeit des Virus‘ durchgeführt werden, diese Gefährlichkeit rückwirkend bestätigen – was, um den falschen Umkehrschluss zu vermeiden, nicht bedeutet, dass das Virus nicht auch gefährlich ist. Im Gegenteil spricht vieles dafür, dass es tatsächlich so bedrohlich ist, wie wir es gerade behandeln. Unter Umständen ist es sogar noch gefährlicher. Dennoch kommt man um die Feststellung nicht umhin, dass das Virus nicht nur über sämtliche unserer Handlungen verfügt, sondern wir umgekehrt fast nur noch das Virus tun. Es fließt in all unsere Handlungen ein und pachtet diese als ihr ausschließlicher Grund für sich. Wir verifizieren durch unsere Handlungen einen Grund, von dem wir noch nicht ganz genau wissen, wie wahr er ist.
Die getroffenen Maßnahmen erfordern einen immens hohen Preis. Die Versammlungsfreiheit, das Recht auf Bildung, die Gewerbe- und die Reisefreiheit sind unter anderem bedroht; das kulturelle Leben ist lahmgelegt; die Gesellschaft wird noch schärfer in Habende und Nicht-Habende hierarchisiert, die ökonomischen Kosten können massiv sein und – damit einhergehend – auch die sozialen Kosten. Das Detailhandelsterben wird weiter beschleunigt, Freiberufler und Künstler bangen um ihre Existenz. Nicht allein die materielle Existenzgrundlage, sondern auch etwas, was man „Anerkennungsstruktur“ nennen könnte, wird vielen Menschen mehr und mehr wegbrechen. Das kann in zunehmender Isolation, Verarmung, Gewalteruptionen von Menschen, die die Spannung nicht aushalten, und Suiziden münden… Zudem scheint der Rechtsstaat bedroht. Die Grundrechte werden beschnitten, es gibt eine gewisse Überwachung per Handy. Läuft also plötzlich alles nach rechtspopulistischem Drehbuch und das ohne, dass die Rechtspopulisten selbst eingreifen müssten? Die Bürger nehmen die Einschränkung ihres Alltages ohne großen Widerstand so hin – und wer sagt denn, dass es nicht so bleibt, wenn der ganze Spuk wieder vorbei ist?
Noch etwas ist zu beobachten. Für den Philosophen Esposito nimmt Immunität den Charakter eines regelrechten Krieges an, in dem es um die Kontrolle, und letzten Endes um das Überleben des Körpers angesichts von äußeren Invasoren geht, die ihn zuerst zu besetzen und dann zu zerstören suchen.[4] Entsprechend kriegerisch ist oft das Vokabular von Büchern zur Immunologie. Aktuell ist aus philosophischen Mund zu vernehmen, dass das Virus weg müsse, ein Virologe spricht von einem Feind, der Krieg gegen unsere Gewohnheiten führt. Unheimlicher freilich ist das Aufkommen autoritärer Gelüste, das sich in Kommentarbereichen in sozialen Medien niederschlägt. Wer nicht hören will, muss fühlen, heißt es da öfters auf Bezug auf Menschen, die sich nicht an die Regularien halten, desweiteren ist die Rede von Wasserwerfern, die jetzt zu Einsatz kommen müssen und Stromstößen, die an Delinquenten verteilt werden sollten, etc.
Strafphantasien werden offen ausformuliert, der Ruf nach einer harten Hand, nach einem autoritären Staat erschallt lauter. So ist die Angst vor der Bereitschaft, mühsam errungene Freiheiten kurzentschlossen preiszugeben, überaus berechtigt. Ist das Dilemma deshalb unumgänglich? Steht hier die Charybdis, die sich aus ökomischen und sozialen Verheerungen sowie einem autoritären Staat zusammensetzt, der jetzt unbedingt nötig ist, um die drohende Ausbreitung des Virus‘ zu vermeiden und dort die Skylla ebendieser viralen Ausbreitung? Nein! Wenngleich der Anlass zu solch einer schroffen Gegenüberstellung gegeben sein mag, liegt die wahre Falle in der Aufstellung solch unvereinbarer Gegensätze selbst.
Es mag zunächst etwas eigentümlich anmuten, den Staat mit einer Krankheit zu vergleichen, aber es gibt eine entscheidende Gemeinsamkeit, die jetzt zum Tragen kommt: Auch der Staat mutiert mit den Menschen, über die er gebietet. Man kann ihn sowohl als eine Art notwendige Krankheit verstehen, zeugt er doch von der Unfähigkeit des Menschen, sich selbst ausreichend im Zaum zu halten, wie auch als nicht minder notwendige Heilung dieser Krankheit, und zwar aus exakt demselben Grund: Wenn das auch mitunter notdürftig geschieht, heilt er den Menschen fortlaufend von der Krankheit des sich-selbst-nicht-ausreichend-im-Zaum halten-Könnens. Da der sowohl kranke wie auch heilende Staat ein überaus menschliches Erzeugnis ist, gilt für seinen Erzeuger dasselbe: Er ist immer sowohl krank, wie er auch schon ein Heiler seiner selbst ist.
Im Begriff der Staats-Gewalt vereint sich Gegensätzliches. Auf einen einzelnen Menschen wirkt der Staat als gebietende und/oder verbietende Gewalt ein, doch gerade weil er die je Einzelnen zurückbindet, öffnet er ihnen im selben Zug einen Raum, indem sie sich entfalten können. Die menschliche Freiheit spielt sich in einem Dazwischen ab. Bezüglich dieses Dazwischens existiert ein breiter Spielraum zwischen fast keiner und recht viel Freiheit. Deshalb gilt für den Staat selbst das, was für die Maßnahmen gilt, die er aktuell durchsetzt: Er muss von der Mehrzahl seiner Angehörigen in quasi-religiöser Weise fraglos „geglaubt“ werden. Seine Herrschaft funktioniert nur solange, als nicht nur der Glaube an die Nützlichkeit, sondern auch an seine Rechtmäßigkeit und seine Legitimität bei seinen Untertanen, den Machteliten und dem Personal in seinem Dienst aufrecht erhalten wird.[5] Auch hier wäre zu ergänzen, dass jene, die das nur bedingt tun, sich zumeist gezwungen sehen, so zu handeln, als ob sie an ihn glauben würden. Ihm selbst ist es eher egal, ob er wirklich geglaubt wird oder nur getan wird als ob, wichtig ist ihm, dass in einer Weise gehandelt wird, die seine Existenz bestätigt.
Dass der Staat geglaubt werden muss, verweist darauf, wie falsch es ist, einen schroffen Gegensatz zwischen ihm und seinen Bürgern zu zeichnen. Da die Bürger, ob sie das wollen oder nicht, integraler Teil des Staatskörpers sind, verändert er sich mit der Weise, wie sie auf ihn einwirken. Vielleicht lässt sich über ihn das sagen, was für einen Fußball-Schiedsrichter gilt: Er verrichtet seine Arbeit dann einigermaßen ordentlich, wenn seine Anwesenheit so wenig wie möglich bemerkt wird. Er kann einem aber durchaus auch als quasi-Monster erscheinen, dem man fast ohnmächtig gegenübersteht. Aufgrund gegebener Umstände ist der Staat aktuell so präsent wie selten zuvor. Just deshalb gilt es, das oben beschriebene falsche Dilemma zu umschiffen. Dazu könnten Böckenfördes vielzitierte Worte auf die gegebene Situation angewendet werden. Ihm zufolge lebt der freiheitliche, säkularisierte Staat von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist.[6] Man erhält als Bürger gewissermaßen einen Vertrauensvorschuss, mit der gegebenen Freiheit würdig umzugehen. Nun, wo sie wegzubrechen droht, gilt es umso mehr, sich der gegebenen Freiheit gewachsen zu erweisen.
Man sollte Verantwortung für sich übernehmen – eine, die immer schon eine ist, die die Mitmenschen impliziert. Anlass für einen flachen Optimismus bezüglich der übermittelten Verantwortung ist nur bedingt gegeben. Es scheint ja tatsächlich haufenweise Menschen zu geben, die die basale Tatsache ignorieren, dass sie nicht die einzigen auf diesem Planeten sind, die gewisse Notdürfte zu verrichten haben und danach gerne wieder einen gepflegten Anus vorfinden würden.[7] Auch die aktuell zu beobachtende Kooperation ist zwar einerseits äußerst begrüßenswert, nüchtern betrachtet aber auch nicht viel mehr als die andere Seite einer egoistischen Medaille. In Situationen wie dieser, ist es ein überaus egoistisches Gebot,[8] zu kooperieren, denn natürlich kommt der altruistische Dienst an der Gemeinschaft wieder dem Einzelnen zu Gute. Die Bereitschaft zur Kooperation speist sich aus derselben Anlage wie der Egoismus. Wir sind immer verletzlich, genauso wie wir immer bereit sind, selbst zu verletzen. In der Krise tritt beides akzentuierter hervor.
Dennoch gibt es Beispiele, die zeigen, dass sich das falsche Dilemma noch dort bewältigen lässt, wo es beginnt, richtig zu werden. Als die englische Mandatsmacht in Palästina die jüdische Einwanderung durch das sogenannte „Weißbuch“ beschränkte, fanden sich die dortigen Juden in der unmöglichen Situation vor, dass sie zwar mit den Engländern paktieren mussten, kämpften diese doch gegen die Deutschen, es ihnen aufgrund dieser Einwanderungsbeschränkung aber kaum möglich war, das zu tun. David Ben-Gurion löste das Dilemma vermittels folgender Worte auf: „Wir werden Hitler bekämpfen, als ob es kein Weißbuch gäbe, und wir werden das Weißbuch bekämpfen, als ob es keinen Krieg gäbe.“[9] Er rief dazu auf, Militärdienst bei den alliierten Streitkräften zu leisten – was nicht möglich war, ohne eine kritische Distanz beizubehalten.
Freilich lassen sich Kontexte nicht ohne weiteres übersetzen, dennoch könnte geraten sein, das insoweit zu übernehmen, als es einerseits gilt, das Corona-Virus einzudämmen, als würde dadurch kein Freiheitsverlust drohen, und andererseits, die Freiheit zu bewahren, als gäbe es kein Corona-Virus. Und ja, man kann das Unvereinbare zu Maßen vereinbaren: Auch wer den aktuell getroffenen Maßnahmen eine ordentliche Portion Skepsis entgegenbringt, der rückt sie dadurch so weit, wie es aktuell möglich ist, in den Hintergrund, indem er handelt, als ob sie richtig wären – die formale Befolgung schließt eine immer auch noch kritische Haltung keineswegs aus.
Gefordert ist somit ein Doppeldenken, das sein Bestes tut, divergierenden Ansprüchen zu genügen: Man führt gewisse Handlungen zwar aus, aber man tut das nicht, ohne eine kritische Distanz zu ihnen selbst und jenen zu bewahren, die sie einem gebieten. Man kooperiert mit Instanzen, von denen man weiß, dass sie nie nur Helfer sein können, sondern irgendwie auch Gegner geblieben sind. Das wäre denn auch die Bedingung dafür, die bestehenden Freiheiten zu bewahren und jene zum gegebenen Zeitpunkt zurückzufordern, die – vorübergehend? – verloren gehen. Ohne solch einen überaus naiven Glauben hätte nie jemand einer Obrigkeit ein Stück Freiheit abtrotzen können. Die drohende Zunahme der Überwachung kontert man aktuell am ehesten, indem man sich in einer Weise verhält, die demonstriert, dass man niemand ist, der der Überwachung bedarf, weil man verstanden hat, was zu tun ist. Der lächerlich naiv anmutende Glaube, der Staat würde sich in dieser Zeit des (Quasi?-)Ausnahmezustandes nicht in ein alles permanent überwachendes repressives Ungeheuer verwandeln, verhindert unter Umständen – genau das. Da die Verweisungszusammenhänge immer wechselseitig sind, bindet der Staat nie nur uns Einzelne zurück, sondern auch wir können ihn zurückbinden.
Aber es ist nicht nur eine gehörige Portion Naivität gefragt, sondern auch das, was man in etwa als das Gegenteil verstehen könnte. Das wäre Abgebrühtheit oder Coolness. Den Spagat zwischen Naivität und Abgebrühtheit müssen wir insoweit leisten, als wir uns zumindest glauben lassen müssen, uns gelänge es auch bei zunehmenden Spannungen zumindest so zu tun, als ob wir fürderhin cool wären. In dieser Situation wird noch deutlicher, welch gewichtiger Handlungsfaktor die Zeit ist. Die Coolness ist dazu dienlich, trotz prekärer Lebensbedingungen und schwer zu ertragender Ungewissheiten alles solange halbwegs stabil zu halten, bis mehr belastbare Informationen vorliegen. Kurz: Coolness kauft jetzt Zeit.
Das Ausgeliefertsein an Ungewissheiten ist so zwar zu einem Maß hinzunehmen, doch ist es immer auch geboten, selbst darauf zu achten, wo Lücken sind, um diese irgendwie zu schließen sind, anstatt die eigene Ohnmacht zu beklagen. Das besagte Doppeldenken, das die Entscheidungsträger immer auch kritisch begleitet, sollte deshalb weniger hämisch auf die Inkompetenzen hinweisen, die es gegeben hat und weiter geben wird, sondern eher versuchen, diese aufzufangen, wo sie evident werden. Ein gewisses Misstrauen wird weiterhin involviert sein. Das braucht man auch nicht aufzugeben, aber man kann es erstmal im eigenen Kopf aufbewahren. Anzufügen wäre noch, dass kaum etwas billiger ist, als es im Nachhinein besser gewusst zu haben. Ein Denken, das zumindest versucht, das Unvereinbare zu vereinbaren, könnte sich zudem als effektives Mittel gegen aufkeimende autoritäre Gelüste und Strafphantasien erweisen.
Im selben Zug hält das Doppeldenken nie nur die virale Bedrohung, sondern, so gut es möglich ist, immer auch die ökomischen und sozialen Verwerfungen, zu denen es weiter kommen wird, im Auge. Die Reserven von Jeff Bezos sind groß genug, um sicher durch die Krise zu kommen, jene von dem Buchhändler ein paar Straßen weiter, unter Umständen nicht. Also weißt Du, wo Du Dir Dein Buch oder was auch immer es sei, besorgen solltest. Tatsächlich wird die Frage, ob divergierende Ansprüche zu vereinbaren sind, allerorten beantwortet. Das Netz quillt über vor teils überaus originellen, teils eher infantilen Angeboten. Man kann sie wahrnehmen.
All das dürfte wieder abflachen, wenn sich das alles wieder normalisiert – wann immer das sein wird. Deshalb halte ich die aufkommenden Spekulationen über irgendwelche Post-Corona-Utopien für eher zynisch. Ich würde davon ausgehen, dass vieles ziemlich genau gleich sein wird. Aufgrund zu erwartender Verheerungen würde ich tendenziell von einem noch bittereren Konkurrenzkampf um die Plätze an der Sonne ausgehen. Aber gegebenenfalls lässt sich sogar mein Pessimismus zu Maßen falsifizieren. Wenn es uns nur gelingt zu handeln, als ob wir ein bisschen klüger geworden sind, dann sind wir in den Konsequenzen daraus tatsächlich ein bisschen klüger geworden…
Zum Autor: Manuel Güntert hat Soziologie, Philosophie und Politikwissenschaften an der Universität Konstanz studiert und dort auch promoviert. Er veröffentlicht demnächst ein Buch über den ontologischen Gottesbeweis und schreibt einen Blog.
[1] R. Porter, Die Kunst des Heilens. Eine medizinische Geschichte der Menschheit von der Antike bis heute. Heidelberg/Berlin 2000: S. 30.
[2] S. Winkle, Geißeln der Menschheit. Kulturgeschichte der Seuchen. Düsseldorf 2005: S. 608.
[3] D. S. Thomas/W. I. Thomas, The Child in America. Behavior Problems and Programs. New York 1928: S. 572.
[4] R. Esposito, Immunitas. Schutz und Negation des Lebens. Berlin 2004: S. 215.
[5] W. Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart. München 1999: S. 21.
[6] E-W. Böckenförde, Recht, Staat, Freiheit. Frankfurt am Main 1991: S. 112.
[7] Wie es aussieht, wenn wirklich tragische Entscheidungen gefällt werden müssen, also beispielsweise solche, welches Leben bei Knappheit von Beatmungsgeräten erhalten wird und welches nicht, darüber gibt diese Seite Auskunft: https://www.samw.ch/de/Ethik/Themen-A-bis-Z/Intensivmedizin.html?fbclid=IwAR1Gu7eziQ6OBQWRTNHzR7Tj_YieT0j-G0AgkD7kgtmiSpaHrRN0ROJQCFg
[8] Slavoj Žizek kritisiert Agamben zurecht dafür, das Virus zunächst als eine Art Konstruktion zu betrachten. Darin liegt eher die Ideologie als in der von Agamben behaupteten ideologischen Durchsetzung. Dennoch tut Žizek in gewisser Weise dasselbe wie der von ihm Kritisierte: So wie Agamben die Gelegenheit nutzt, seine Theorie des Ausnahmezustandes durchzuboxen, benutzt er sie, um, des performativen Widerspruches nicht genug, seiner Theorie des Kommunismus Aufschwung zu verleihen. Beiden denken von ihren eigenen Wirkungen und nicht von der Ursache her. Einen kritisch kommentierten Einblick in die „Philosophen-Debatte“, in der auch noch Esposito und Nancy mitmischen, gibt dieser Blog: https://www.diebresche.org/der-coronavirus-und-die-philosophie/
[9] A. Shapira, Land and Power. The Zionist Resort to Force, 1881-1948. New York/Oxford 1992: S. 279.