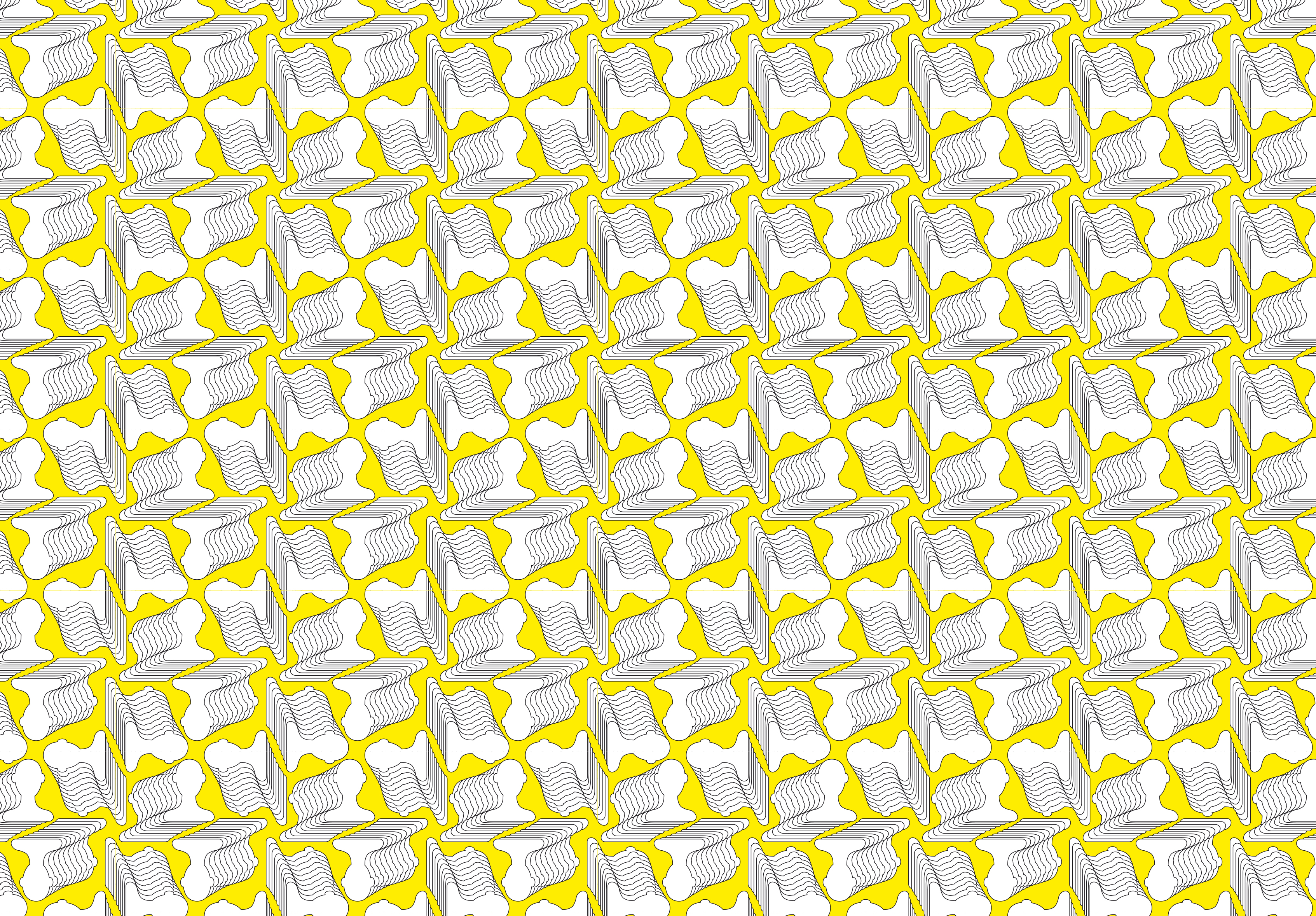Wie kann ich so leben, wie ich es gern möchte? Diese Frage stellt sich wohl jeder, der einen genaueren Blick auf sein Leben wirft und sie ist immer wieder Bestandteil gesellschaftlicher Debatten. Macht der Kapitalismus unfrei? fragen die einen. Werden wir von den sozialen Medien manipuliert? die anderen. Oder auch: Wie können wir die Strukturen der Diskriminierung durchbrechen, die die #metoo-Debatte anklagt?
Beate Rössler, Professorin für Philosophie an der Universität Amsterdam, ist für diese Themen genau die richtige Gesprächspartnerin. Seit Jahren erforscht sie das Gebiet der Autonomie.
Bekannt wurde die Philosophin zunächst durch ihr Buch »Der Wert des Privaten« (2001), in dem sie eine Theorie des Privaten für die moderne, vernetzte Gesellschaft entwirft, die später reichlich philosophisches Futter für die Debatte um Überwachung lieferte. Eine der Grundthesen Rösslers lautet: Privatheit ist eine Voraussetzung für Autonomie.
»Autonomie« ist auch der Titel ihres aktuellen Werkes, das noch größeres Medieninteresse geweckt hat. Weshalb Selbstbestimmung gerade heute eine so wichtige Rolle spielt, darüber möchten wir mit ihr reden. Beate Rössler empfängt uns zum Gespräch in ihrem Büro auf dem Uni-Campus in Amsterdam, der mitten im historischen Stadtkern liegt. Von ihrem Büro blickt man direkt auf den zentralen Rokin-Kanal: »Ja, manchmal schaut man hier ein bisschen zu viel aus dem Fenster«, sagt die Philosophin und lacht. Sie hat sich zwei Stunden Zeit genommen, um mit uns zu sprechen. Wir wollen von ihr wissen: Was bedroht die Autonomie in liberalen Gesellschaften? Und wie kann sie dennoch gelingen?
HOHE LUFT: Frau Rössler, Autonomie scheint ein Thema unserer Zeit zu sein. Freiheit und Unabhängigkeit – das wünschen sich die Menschen heute sehr. Hängen wir die Autonomie zu hoch?
BEATE RÖSSLER: Ich glaube, das ist ein Missverständnis des Autonomiebegriffs. Man assoziiert Autonomie mit Einsamkeit, Unabhängigkeit, sich loslösen von allem, nur auf den eigenen Lebensweg, die eigenen Leistungen schauen und so weiter. Deswegen wird mir und anderen Autonomie-Theoretikern auch oft vorgeworfen, dass das so gut passt zur neoliberalen Wirtschaft. Aber das ist nicht der Autonomiebegriff, den ich in meinem Buch entwickle und auch nicht der, der in den wichtigen Theorien der Gegenwart vertreten wird.
Was ist an Ihrem Autonomiebegriff anders?
Vor allem finde ich es wichtig, zu sehen, dass man nicht allein autonom ist, dass man autonom immer in sozialen Kontexten steht. Von denen muss man sich gegebenenfalls lösen können, aber sie sind doch auf jeden Fall Möglichkeitsbedingung für das autonome Leben. Ich denke, Autonomie ist viel mehr relational.
Wie meinen Sie das?
Was relationale Theorien von Autonomie zu fassen und zu erklären versuchen, ist folgendes: Autonomie bedeutet nicht, dass ich mich gegen andere, nur mit dem Ziel meiner eigenen individuellen Unabhängigkeit entscheiden muss, sondern dass ich immer im Dialog mit anderen entscheide, was ich will. Wir bewegen uns immer schon in sozialen Kontexten und müssen andere respektieren, um das eigene autonome Leben leben zu können. Ich finde es interessant zu sehen, dass auch in der Philosophie noch viele der Meinung sind, dass Autonomie eigentlich bedeuten muss, dass man sich nur gegen die anderen, für die eigenen Interessen verhalten muss. Ich glaube demgegenüber, dass Autonomie bedeuten muss, dass wir sehen, dass die eigenen Interessen, Vorstellungen, Ideen auch immer in Zusammenhang mit anderen entstehen und ausgelotet werden und gegebenenfalls gegen andere oder auch mit anderen durchgesetzt werden müssen.
Was zählt noch zu Ihrer Auffassung von Autonomie?
Eine autonome Person muss in der Lage sein, über ihr Leben nachzudenken und darüber, was sie eigentlich möchte und als was für eine Person sie sich verstehen will – auch in ihren Beziehungen, ihren Emotionen, ihren Vorstellungen, Werten, Wünschen usw. und sich dazu verhalten. Das ist noch kein sehr anspruchsvoller Autonomiebegriff, aber ich versuche das im Verlauf des Buches genauer zu machen und mehr Bedingungen zu formulieren zum Beispiel, dass ich begründet handele. Wenn Sie mich fragen: ‚Warum haben Sie das gemacht?‘, muss ich sagen können: Das habe ich aus diesen und jenen, guten, überzeugenden, für mich besten Gründen gemacht. Das betrifft Fragen wie: Will ich eigentlich das gleiche machen wie meine Eltern? Wie verhalte ich mich in Beziehungen? Aber auch viel unwichtigere Fragen wie: Will ich heute mit XY ins Kino? Das klingt trivial, aber ich will zeigen, dass Autonomie kein abstrakter Begriff ist, der ab und zu mal relevant wird im Leben, wenn man sich gerade fragt ‚Was soll ich studieren?‘, sondern der wirklich integriert ist in unser Leben.
In Ihrem Buch schreiben Sie: »Autonomie ist keine Eigenschaft, sondern eine Fähigkeit, die man lernen kann«. Wie können wir lernen, autonom zu sein?
Mit dem Lernen meine ich, dass wir nicht als autonome Personen geboren werden. Wir müssen Kindern beibringen, was es heißt, eigenständig zu entscheiden und Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen.
»Es geht nicht darum, zu tun was ich will, sondern darum, mir bewusst zu sein, warum ich das will«
Was Erwachsene betrifft, lebt ja beispielsweise die Psychoanalyse von dieser Idee, dass man sich über sich selbst aufklärt, über die eigenen inneren Hindernisse und Beschränkungen, mit der Hilfe einer Analytikerin und das ist dann natürlich ein Autonomiegewinn. Grundsätzlich könnte man sagen, braucht es dazu ein bestimmtes Selbstverhältnis, das heißt, ich muss in der Lage sein, mich auf mich selbst zu beziehen, darüber nachzudenken, ob ich das eigentlich wirklich will, von dem ich gerade denke, dass ich es will. Das heißt, was unbedingt dazu gehört zum autonomen Leben, ist ein Bewusstsein dafür, dass es möglich ist, dass ich mir selbst nicht transparent bin.
Und woher wissen wir, was wir wollen? Sich selbst transparent zu sein, ist doch schon die erste Hürde.
Ja, es ist schwierig, sich transparent zu sein und es gibt keinen Punkt, an dem ich sagen kann, jetzt weiß ich wirklich genau, was ich will. Das gibt es manchmal in einzelnen, ziemlich trivialen Situationen: Ja, ich will heute Abend wirklich ins Kino. Aber auch: Ich bin wirklich sehr froh, dass ich Philosophie studiert habe. Oft ist es jedoch schwieriger, das herauszufinden und sich zu entscheiden. Diese Ambivalenzen sind ganz normal und bedeuten nicht, dass man nicht autonom ist. Im Gegenteil, sie können einen dazu bringen, genauer nachzudenken, was man will. Es verhindert eher Autonomie, wenn man denkt, man wüsste immer ganz genau, was man will und dass man keinerlei Selbstzweifel hat und keine Zweifel daran, ob man den richtigen Weg gewählt hat.
Sie zitieren in Ihrem Buch auch den amerikanischen Philosophen Harry Frankfurt, der der Ansicht ist: Man ist nicht frei, wenn man nur das tun kann, was man tun will, sondern dann, wenn man überhaupt etwas wollen kann.
Ja, wenn ich überhaupt die Möglichkeit habe, mich zu mir selbst zu verhalten, mich dazu zu verhalten, dass ich verschiedene Dinge wollen kann und dass ich die Freiheit habe, mich auch falsch zu entscheiden.
Ihrer Ansicht nach ist es autonom, aus eigenen Gründen zu handeln. Dabei galt es doch auch mal als selbstbestimmt, seinen möglicherweise unklugen Wünschen gerade nicht zu erliegen, sondern darüber erhaben zu sein.
Das stimmt schon, aber mir geht es eben nicht nur um Wünsche, sondern auch um Gründe. Darum, dass wir uns überlegen können, was wir wollen und uns dann entsprechend verhalten. Davon spricht auch Frankfurt in seinem hierarchischen Autonomiemodell, da gibt es die »first order desires«, das wären die Wünsche und wer autonom sein will, sollte noch eine Stufe höher gehen zu den »second order desires«, die den ersten widersprechen können und es sich dann noch mal überlegen.
Ich will rauchen, aber ich will auch nicht rauchen.
Genau. Ich will rauchen, aber eigentlich möchte ich jemand sein, die nicht raucht. Das ist sozusagen die nächste Stufe und dann wäre die autonome Entscheidung, nicht zu rauchen. Oder Sie möchten rauchen und dann denken sie: Naja, ich finde es auch nicht schlimm, jemand zu sein, die ab und zu raucht. Oder Sie sagen: Ich merke, dass ich total abhängig bin vom Rauchen, aber es macht mir nicht viel aus, eine Person zu sein, die abhängig ist vom Rauchen. Es ist egal, was da rauskommt. Hauptsache, Sie sind überhaupt in der Lage, sich zu diesen »first order desires« zu verhalten. Bei Frankfurt sind da allerdings nur Wünsche relevant – keine Gründe – und auch nicht die Reflexion darauf, woher diese Wünsche eigentlich kommen; das finde ich unzureichend in seinem Modell.
Kant meinte, ein Mensch sei entweder autonom oder eben nicht, dazwischen gäbe es nichts. Das sehen Sie also anders?
Ja, ich denke, man muss eine gewisse Schwelle übertreten, um als autonomer Mensch zu gelten, aber darüber hinaus gibt es viele Graduierungen. Das sieht man gut an dem Prozess des Lernens der Autonomie, über den wir gerade gesprochen haben. Man kann sich ja fragen, was steht mir eigentlich im Weg? Warum mache ich immer die gleichen Fehler? Warum bin ich so unglücklich in meinem Beruf?
In der Tat: Was steht uns denn im Weg? Haben wir in unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft nicht Spitzenbedingungen für Autonomie?
Das sind auf der einen Seite eher individuelle Probleme. Dass man mit 40 Jahren endlich mal lernen muss, sich von seiner Mutter oder seinem Vater zu lösen oder von der Illusion, dass man die geborene Rechtsanwältin ist. Das sind Probleme, die entstehen, wenn man in einer Gesellschaft lebt, in der man die Freiheit hat, sich zu entscheiden und zugleich auch die Verantwortung, jedenfalls die ethische Verantwortung, hinter dem eigenen Leben zu stehen.
Eigentlich war das doch das große Versprechen der Moderne: den Menschen frei zu machen. Stecken wir stattdessen in neuen Zwängen wie Konsum, Beschleunigung, Selbstoptimierung? Sind wir heute weniger autonom?
Ja, es stimmt, das ist das große Versprechen vor allem der Aufklärung, an dem wir festhalten trotz fundamentaler Kritik. Denn es stimmt ja, dass nicht alles immer freier wurde. Mit den Veränderungen der Wirtschaftsverhältnisse, der Arbeitsverhältnisse und dann im 20. Jahrhundert der technologischen Revolution kommen auch gleichzeitig neue Einschränkungen der Freiheit und demokratischen Verhältnisse zum Ausdruck. Jetzt kann man sagen, diese Entwicklungen würden zeigen, dass Freiheit, wie Kant und andere sich das im 18. Jahrhundert vorgestellt haben, eigentlich gar nicht möglich ist. Man kann aber auch sagen: Es gibt nun einmal immer wieder andere und sich strukturell verändernde Einschränkungen von Freiheit, derer man sich bewusst sein muss, um sie dann kritisieren zu können, um zu zeigen, in welcher Weise individuelle Freiheit oder Autonomie möglich ist. Das ist eher mein Zugang zu diesen Entwicklungen.
Das heißt, wir sind immer noch besser dran, weil wir darauf reagieren können?
Ja, klar. Natürlich stimmt es zum Beispiel, dass Frauen immer noch unterdrückt werden. Aber das hindert uns beide nicht daran, uns hier gegenüber zu sitzen und Sie haben einen guten Job und ich habe einen guten Job. Wir haben diese Jobs halbwegs autonom gewählt, das ist ja auch ein Zeichen, dass Autonomie eben doch möglich ist trotz dieser Strukturen, die man immer weiter kritisieren muss und zu denen man nicht einfach sagen kann: Ja, Gott, also wenn Frauen das können, so wie Sie oder ich, was ist dann noch das Patriarchat? Das stimmt eben nicht. Das ist das eine. Und der Konsumismus, den Sie angesprochen haben, also die Manipulationen, denen wir ausgesetzt sind durch den Kapitalismus, sind das Strukturen, die unsere Freiheit vollkommen verhindern? Nein, denn wir können sie kritisieren und daran arbeiten, sie zu verändern. Juristisch, gesellschaftlich, zum Beispiel mit Datenschutzrichtlinien etc. Dazu kommen natürlich ökonomische Ungerechtigkeiten, Armut, die ebenfalls Freiheit einschränkt. Das sind alles Strukturen, die es uns schwer machen in unserer Gesellschaft, aber die Freiheit nicht unmöglich machen für individuelle Personen. Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich das Recht habe, etwas zu tun und durch die Umstände daran gehindert werde, etwas zu tun. Oder ob ich nicht einmal das Recht habe.
Wie ist es mit Sozialen Medien, sehen Sie in Ihnen eine Gefahr für die Autonomie?
Nein, es gibt viele Dinge, die man daran kritisieren sollte, etwa wie Unternehmen sie zu Werbezwecken nutzen, die ich als User nicht durchschauen kann. Aber generell könnte man auch sagen, dass diese Kommunikation für die jungen Erwachsenen autonomiefördernd ist, weil sie sich auf ganz andere Weise unterhalten können und mit neuen emanzipatorischen Inhalten konfrontiert werden, wie etwa den sehr offenen Diskussionen um Feminismus, zum Beispiel auf youtube. Das hilft, über die eigene Identität nachzudenken und darüber, wie man leben will. Dass das zu viel und auch beliebig werden kann und Jugendliche unter einen sozialen Druck setzt, das gestehe ich alles zu, aber man darf dieses emanzipatorische Element nicht unterschätzen.
Aber ist es nicht auch problematisch, dass sich dort alle unsere Rollen vereinen? Ich bin auf Facebook beispielsweise mit meinen Kollegen, meinen Eltern, meinem Ex-Freund und meinen Nachbarn befreundet…
Oh, das ist schlecht. Aber auch kein Grund, die Sozialen Medien zu verdammen, das lässt sich ja leicht ändern mit »audience seperation«-Einstellungen.
Warum ist das so schlecht?
Weil Privatheit eine unbedingte Voraussetzung für Autonomie ist.
Aus welchem Grund?
Es ist schlecht, wenn alle Rollen, die Sie im Leben einnehmen, zusammenfallen. Es ist Ausdruck von meiner Autonomie, dass ich hier sitzen kann als Professorin und Sie als Journalistin. Das ist eine Rolle, die Sie haben im Leben, aber die ist notwendigerweise darauf angewiesen, dass Sie die anderen Rollen leben können, ohne, dass diese vermischt werden. Wenn Sie jetzt alle Peinlichkeiten aus meinem privaten Leben wüssten, dann könnten wir dieses Interview nicht führen, sie wären konstant abgelenkt durch irgendwelche Assoziationen. Stellen Sie sich vor, sie säßen bei der Psychotherapeutin und die würde plötzlich anfangen aus ihrem privaten Leben zu erzählen, von ihrem Vater oder so. Das wäre ein Einbruch von ihrem privaten Leben in Ihres und sofort wären die Rollen der Patientin und der Therapeutin unmöglich. Das ist der Zusammenhang zwischen Autonomie und Privatheit. Wir brauchen diese verschiedenen Rollen, weil wir Freiheit in unseren modernen komplexen Gesellschaften in verschiedenen Rollen leben und nur leben können, wenn wir die Rollen trennen können und das können wir nur wenn die sozialen Normen der Privatheit respektiert werden.
Manche sagen, es wäre besonders authentisch, wenn wir uns überall so zeigen, »wie wir sind«.
Das halte ich erstens für empirisch falsch. Und zweitens ist das auch ein falscher Begriff von Authentizität. Als ob ich authentisch nur wäre entweder in der Gesamtheit meiner Rollen oder aber nur zu Hause, wenn ich alle Masken fallen lasse. Diese Idee von Authentizität ist ein Missverständnis. Authentizität ist für mich eher ein Selbstverhältnis, eine Frage, inwieweit ich mich mit mir und den verschiedenen Rollen, die ich habe, identifizieren kann. Der Gegenbegriff der Authentizität wäre der der Entfremdung. Bin ich entfremdet von meinen Rollen? Ist das wirklich die Art und Weise, wie ich mich hier präsentieren will oder mache ich allen hier nur etwas vor? Wenn ich also halbwegs nicht entfremdet die unterschiedlichen Rollen spielen kann, dann bin ich authentisch.
Kommen wir zu einem anderen aktuellen Thema. Wie sehen Sie die Debatte um #metoo unter Aspekten der Selbstbestimmung?
Ich sehe da eindeutige Anknüpfungspunkte. Es ist auf jeden Fall ein Freiheitsgewinn, wenn man in der Lage ist, darüber zu reden, in welcher Weise man diskriminiert, verletzt usw. worden ist und wie dies das eigene Leben auch bestimmt hat.
Die Journalistin Ursula März schrieb in der Wochenzeitung »Die Zeit«, die Frauen sollten sich in den betreffenden Situationen mehr wehren, statt sich hinterher zu beschweren. Wenn die Hand wiederholt auf dem Knie landet, einfach mal den Ellenbogen in die Rippen hauen.
Das ist absurd.
Aber eine Polizistin, die zu Sexualstraftaten ermittelt, erzählte neulich, dass es bei sexueller Belästigung tatsächlich in der Situation oft gar nicht viel braucht, sondern viele Täter schon zurückschrecken, wenn man sich gerade macht und sagt: »Was machen Sie denn da?« Warum fällt es vielen so schwer, in dem Moment zu einer selbstbestimmten Reaktion zu finden?
Weil es ja gar nicht nur um diese Situation in einem luftleeren Raum geht, sondern die meisten dieser Fälle in Machtstrukturen verwoben sind, die verhindern, dass Frauen sich in solchen Situationen wehren können. Die jungen Schauspielerinnen etwa waren so abhängig von dem Filmproduzenten Harvey Weinstein, dass sie die Freiheit nicht hatten, den Respekt einzuklagen, der ihnen verweigert wird. Darauf beruht dieses ganze System, dass eine Gruppe von Personen nicht in der Lage ist, den Respekt einzuklagen, während eine andere ihn einfach verweigern kann. Das ist eine psychologisch sehr seltsame Situation, in der man sich für etwas schämt, das man überhaupt nicht getan hat und Fremdscham empfindet für den anderen, der so etwas tut. Und aus dieser Situation kommt man nicht so einfach raus, weil beides abgesichert ist durch diese Machtstrukturen. Es gibt Formen der Unterdrückung, die subtil sind und manchmal auch zu subtil, als dass sie überhaupt juristisch erfasst werden könnten und trotzdem verletzend und autonomieverhindernd.
Sollten wir den Mangel an Autonomie also mit Autonomie bekämpfen?
Ja, aber Autonomie gibt es ja nicht ohne die sozialen Kontexte, das ist eben der Punkt. Das ist das Dilemma, dass Selbstbestimmung durch soziale Bedingungen ermöglicht wird, aber wenn sie diskriminierend sind, auch dadurch verhindert wird. Die Philosophin und Schriftstellerin Iris Murdoch hat es so formuliert: »Man steckt immer schon bis zum Hals im Leben.« Aber das ist auch eine Chance. Denn man kann – wie bei #metoo – bei den sozialen Bedingungen ansetzen und sie kritisieren und wenn die Umstände gut sind, entsteht daraus eine Bewegung gegen Sexismus, die sehr viel Menschen zu mehr Selbstbestimmung ermutigt.
Das Interview führte Maja Beckers