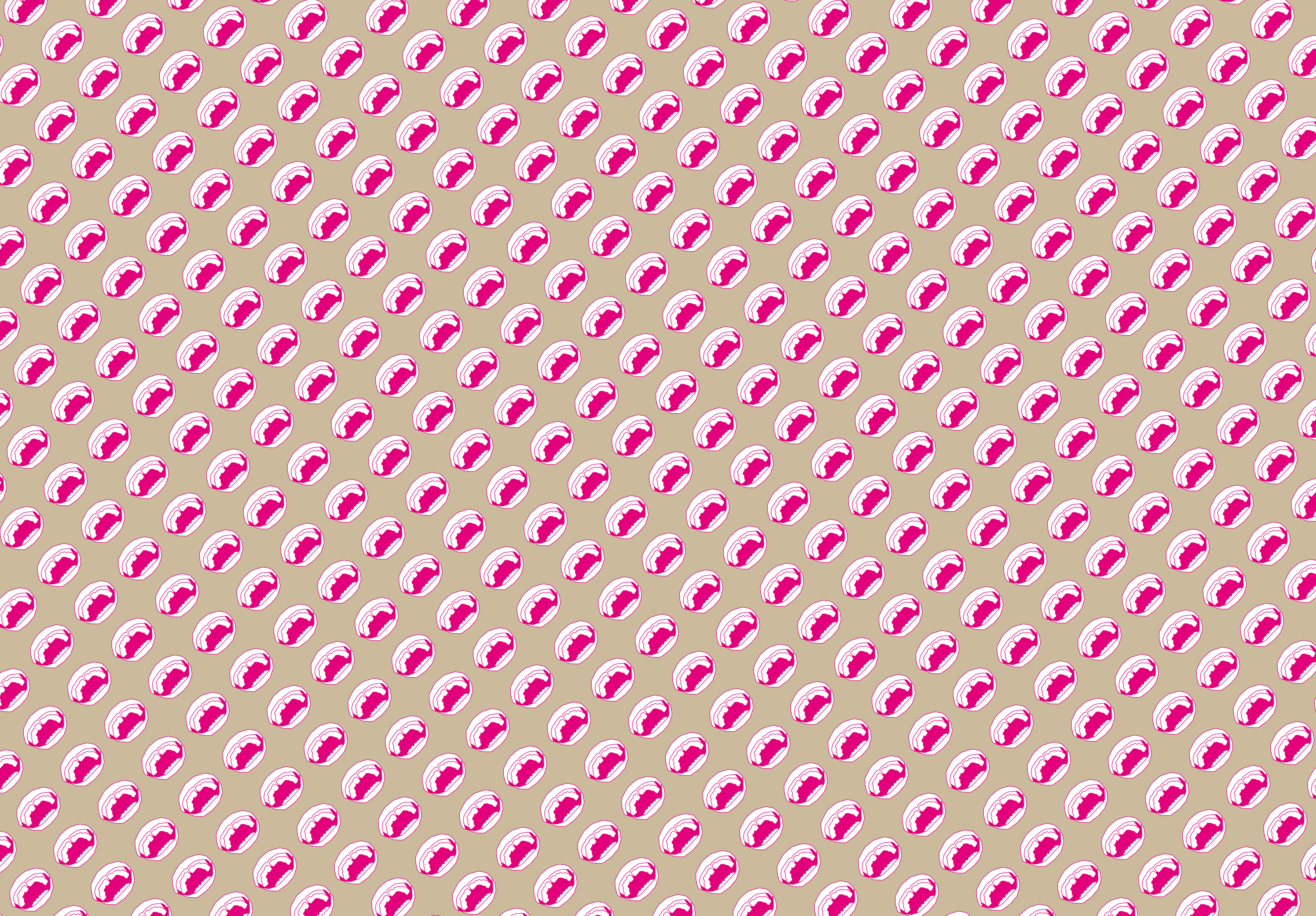Was ist eigentlich Schmerz? Ist er allein ein Übel, oder kann man ihm auch Gutes abgewinnen? Hat er einen Sinn? Gibt es Erlösung? Sollten wir uns mit ihm anfreunden? Eine kritische Befragung des »Weh« und unseres Umgangs mit ihm.
Schmerz macht klein und dehnt aus, staucht und streckt, schießt auf uns herunter und wallt in uns auf, ist ebenso oft der wie mein und nur selten unser.« So versucht die amerikanische Lyrikerin Lisa Olstein zu fassen, was womöglich nie vollständig beschrieben und »gesagt« werden kann. Diese Unfreiheit. Diese Ohnmacht. Man fühlt sich wie ein Käfer in einer Schachtel, der ständig gegen den Deckel anflattert. Wehtun ist etwas, das jeder von uns empfinden, erleben, erleiden muss; körperlich, seelisch, geistig. Es gibt kein Leben ohne Schmerz. Das Drama der Existenz beginnt lautstark mit den Schreien der Gebärenden – und endet leise mit dem Stöhnen des Sterbenden. Geburt und Tod bilden den Rahmen für ein Stück, das zwischen Komödie, Tragödie und Farce changiert und von uns, seinen Protagonisten, bis zuletzt ununterbrochene Präsenz verlangt. Bis der Regisseur ein letztes Mal »Cut!« ruft. Oder bis wir selbst Schluss machen …
Die ergreifendsten und anstrengendsten Szenen sind immer auch die, in denen der Schmerz in den Vordergrund rückt. »Vereinzelt, gelegentlich, intermittierend, häufig, andauernd, schwach, mäßig, stark, gibmir-den-Strick«, schreibt Olstein, die an chronischer Migräne leidet, in ihrem Buch »Weh«. Schon nach wenigen Seiten wird klar: Sie versucht nicht nur etwas über ihren Schmerz zu sagen, sie will ihn auch zeigen. »Manche Grüntöne sind reiner Brechreiz«: Bei diesem Schmerztheater kann man zuschauen – oder möchte es sogar unbedingt –, aber bloß nicht selbst körperlich oder seelisch leiden. Und wenn es doch passiert, fragt man sich: Warum tut es so weh? Warum ich? Versuchen wir daher, anhand einiger klassischer Positionen der Philosophie- und Kulturgeschichte herauszufinden, wie man Schmerz deuten und verstehen kann – und welchen letzten Sinn er haben könnte.
1. IST SCHMERZ IMMER SCHRECKLICH?
Für den Menschen des Jahres 2021 scheint Wehtun grundsätzlich inakzeptabel. Die Geschichte der Zivilisation ist von zunehmender Gefühls- und Triebkontrolle bestimmt; dies zeigt sich deutlich auch in der Art und Weise, wie wir mit Schmerzen umgehen und sie interpretieren. Angehörige der heutigen »Palliativgesellschaft« (Byung-Chul Han) scheinen so gut wie jede Art von Wehtun als Skandalon zu werten. Es dominiert das medizinisch-therapeutische Ideal der Schmerzfreiheit. Schulter-Nacken-Verspannungen, Fibromyalgie, Liebeskummer, Trauer, zu kalt, zu heiß? Egal was. Schmerzen (auch die eingebildeten) sind grundsätzlich unnötig, müssen pathologisiert, sediert, vergessen, abgestellt werden! Wehtun ist höchstens beim Gebären, beim Sport oder bei Schönheitsbehandlungen erlaubt. Was ist der Sinn des Schmerzes?
Das 21. Jahrhundert ringt um Antworten. Weil das christliche Weltbild abhandengekommen ist, kann man Schmerz nicht als gottgesandte Strafe oder Prüfung annehmen. Weil in Zeiten metaphysischer Obdachlosigkeit der Sinn für die conditio humana und die Grenzen der Machbarkeit fehlt, lässt er sich nicht mal mehr als notwendiges Übel wertschätzen – außer es steht ein bestimmtes, erfolgversprechendes Ziel dahinter (siehe oben): ein neuer Mensch! Ein optimierter Körper! Für René Descartes (1596–1650) war Schmerz einst nicht nur eine überaus erträgliche, sondern auch sehr nützliche göttliche Erfindung zum Schutz und Erhalt des Lebens. Er sah im Schmerz ein verbindendes Element zwischen Körper und Seele; ein Instrument, mittels dessen der Mensch seinen Organismus wie seine Umwelt besser verstehen lernt. Im 17. Jahrhundert werden – auch dank neuer medizinischer Erkenntnisse über das menschliche Nervengewebe und die physiologischen Grundlagen der Selbstwahrnehmung – Sensibilität, Empfindsamkeit, Instinkt zu zentralen Kriterien für die Wissenschaft des Kunstschönen. Die philosophische Ästhetik (von griech. aisthesis für »sinnliche Wahrnehmung«) widmet sich nicht mehr den aus der Antike tradierten Regeln objektiv erkennbarer Schönheit, sondern interessiert sich, von Medizin und Anthropologie inspiriert, dafür, wie Kunst spontan auf den Menschen wirkt. Was diesen reizt, was ihm gefällt oder missfällt, wird zur subjektiven Geschmackssache erklärt.
In seinen »Philosophischen Untersuchungen über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und Schönen« schlägt der Schriftsteller, Philosoph und Politiker Edmund Burke (1729–1797) eine interdisziplinäre Brücke zwischen Physiologie und Ästhetik, indem er die körperlichen Erfahrungen von Schmerz und Gefahr unter ästhetischen Gesichtspunkten analysiert: Weil Schmerz die physische Integrität des Menschen bedroht und eine völlig andere Qualität des Empfindens darstellt als die des Schönen, gehört seine Wirkung in den Bereich des Sublimen oder Erhabenen; eines durch und durch überwältigenden Gefühls. Ob die Schmerzen künstlich erzeugt oder real erlebt sind, ob sie mit einer Theateraufführung oder einem Naturphänomen zu tun haben, ist dabei sekundär. Im Kontext ästhetischer Inszenierungen empfindet man Schmerzen allerdings nicht nur als schrecklich, sondern auch als seelisch lustvoll – und hier entdeckt Burke, zum ersten Mal in der Kulturgeschichte, die positive Bedeutung von Schmerz. Wehtun kann für den Betrachter nicht nur erträglich sein, sondern sogar wünschenswert! Da eine hochemotionale, schmerztriefende Tragödie ebenso wie ein Gladiatorenkampf Nerven und Gemüt stimulieren und das subjektive Wohlbefinden steigern, schreibt Burke dem Erhabenen mehr als bloß »delight« zu: eine therapeutische Wirkung …
2. KANN SCHMERZ THERAPIE SEIN?
»Fünf Uhr morgens, Tunnelblick, verzweifelt darauf wartend, dass die Medikamente wirken«, so Lisa Olstein. Migräne heißt für sie immer Leid, nie Heilung. An ein den Körper, die Seele und den Geist überflutendes Wehtun, wie die Lyrikerin es beschreibt, dachte Immanuel Kant (1724–1804) sicher nicht, als er den Schmerz nach erkenntnistheoretischen und ästhetischen Kriterien untersuchte. In der »Anthropologie in pragmatischer Hinsicht« definiert der Rationalist strengster Observanz schmerzvolle Empfindungen als willkommene Störung, die von der Natur »zwischen angenehme und den Sinn unterhaltende Empfindungen« eingestreut wird. In diesem Sinne ist das Wehtun für Kant ein gutes Therapeutikum gegen eine der berühmtesten Modekrankheiten des 18. Jahrhunderts: den so sogenannten Ennui, eine existenzielle Langeweile, die der Philosoph auch »Sättigungsekel« nennt. Für Kant bilden Schmerz und Lust – ähnlich wie schon bei den Epikureern – ein Gegensatzpaar, das Kunst und Leben durch ihr »Widerspiel« rhythmisiert. Aber nicht das Vergnügen, nur das Wehtun macht uns Zeit und Zeitlichkeit sinnlich erfahrbar, indem es den einzelnen Augenblick bewusst erleben lässt – den gegenwärtigen Moment, den man erleidet, und den künftigen (hoffentlich gänzlich schmerzfreien), den man ersehnt.
Wie Kant sieht auch Arthur Schopenhauer (1788–1860) im Wechsel zwischen Schmerz und Lust eine »ästhetische Notwendigkeit« für die menschliche Existenz. Auch für ihn ist der Schmerz ein Mittel der Bewusstwerdung von kostbarer Lebenszeit und der Relativierung von Genüssen, an die man sich gewöhnt hat, für die man gleichgültig und unempfänglich geworden ist: »Die Stunden gehen desto schneller hin, je angenehmer; desto langsamer, je peinlicher sie zugebracht werden: weil der Schmerz, nicht der Genuss das Positive ist, dessen Gegenwart sich fühlbar macht«, heißt es in »Die Welt als Wille und Vorstellung«.
Wie stark soll, kann, darf das Therapeutikum des Wehtuns sein? Wie oft und wie lange kann es wirken, ohne seine Wirkung ad absurdum zu führen? Aus Sicht chronischer Schmerzpatienten mag die Kantische und Schopenhauersche Rechtfertigung vom Schmerz als Heilmittel gegen Indifferenz, Selbstzufriedenheit und Antriebslosigkeit zynisch wirken. Eintönig ist ja nicht nur ständiges Trüffelverspeisen, sondern sind auch intermittierende Schmerzattacken. Was soll an diesen heilsam sein? Das Gleiche gilt für seelisches Wehtun: Liebeskummer, der nicht aufhören will, Trauer, die nicht versiegen kann, Einsamkeit, die nicht endet.
Es stimmt schon: Im Alltag denkt man meist wenig über Bedeutung und Wert der eigenen Existenz nach. Solange man aktiv ist, seinen diversen Geschäften nachgeht und einem nichts wehtut, spürt man weder seinen Körper noch seine begrenzte Lebenszeit. Man ist schlicht zu abgelenkt von der Tatsache, dass dieses Leben endlich ist. Aber hat das nicht auch große Vorteile – ermöglicht uns diese permanente Ablenkung nicht auch erst, überhaupt irgendetwas zu schaffen? Und: Gibt es nicht auch noch einen anderen Weg als den schmerzhaften, um zu erkennen, was täglich auf dem Spiel steht: das bewusst und sinnvoll gelebte Leben?
Wenn es nach Friedrich Nietzsche (1844–1900) geht: auf keinen Fall. Seiner Meinung nach besteht das Problem nicht im Wehtun selbst, sondern nur in unserer Haltung ihm gegenüber. Er ist der erste Theoretiker, der Schmerz nicht erst auf die positiven Empfindungen von Lust und Wohlbefinden bezieht. Vielmehr sieht er das große »Weh« an und für sich als höchst sinnvoll an: Nietzsche lobt es als Warnsignal, Motivation, Belebung, Sensibilisierung und Bedingung der Möglichkeit großer Kunst.
Wenn Nietzsche heute lebte, er würde unsere Gesellschaft inklusive aller Kulturschaffenden für ihre Wehleidigkeit verachten. Er würde uns vorwerfen, dass wir kein Gefühl für die Vitalität des Schmerzvoll-»Tragischen« mehr haben und alles selbst erlittene physische und psychische Wehtun – ob organisch nachweisbar oder imaginiert – sofort narkotisieren (inzwischen gern auch mit True-Crime-Podcasts, Thrillern und Horrorschockern): Stellt euch nicht so an, wagt das große Gefühl, den Aufbruch, die Erlösung – auch wenn oder gerade weil es wehtut! Aber Vorsicht. Jeder Theoretiker (oder jeder Politiker), der wie Nietzsche dazu aufruft, das Heil im Schmerz zu finden, ist ein gefährlicher Verführer. Er macht sich zum Fürsprecher weniger eines freiwillig auf sich genommenen Leidens – im Sinne einer christlichen Passion – als eines Idealmenschen, der sich im Schmerz so wunderbar eingerichtet hat, dass er in totaler Unempfindlichkeit durchs Leben trampeln kann. Sich nur noch mit seinesgleichen umgibt. Jedes Gespür für andere verlernt. Vor Schmerzverzücktheit die Realität nicht mehr wahrnimmt.
3. IST SCHMERZ IRREAL?
Die Medizin kennt Menschen, die das Wehtun ihrer Sprachfähigkeit beraubt. Bei depressiven Patienten etwa gleicht es keinem Gefühl und keiner Empfindung mehr, sondern einer Infragestellung der eigenen Person. Der Schmerz verwischt dann die Grenzen zwischen Ich und Welt, innen und außen – und zeigt so totalisierende Tendenzen, wie auch die amerikanische Essayistin Elaine Scarry meint.
Scarry untersucht extreme körperliche Erfahrungen. Sie definiert Folter und Kriegsgewalt als Paradigma der Schmerzerfahrung und des Problems, Wehtun zu beschreiben und nach außen zu vermitteln. Aber kann man wie Scarry behaupten, dass ein Leiden, dessen Ursache man in Form des geschundenen Körpers zwar sehen kann, das aber selbst unsichtbar bleibt, etwas »Nichtkommunizierbares« darstellt?
Die Autorin trifft eine interessante, aber wenig nachvollziehbare Unterscheidung zwischen seelischem und körperlichem Schmerz. Jener seelische Schmerz, meint sie, kann immerhin erzählt werden und ist so der »sprachlichen Objektivierung fähig«, weil seine Inhalte gewissermaßen verstehbare Bezugsgrößen sind (ein noch unterscheidbares Innen und ein Außen haben). Dagegen hat das extreme physische Wehtun, bei dem der Mensch nur noch stammeln und schreien kann, an sich überhaupt keine Bezüge und »keinen Referenten«. Das physische Trauma bleibt als »unverstehbar« und »undenkbar« in der betroffenen Person eingeschlossen, quasi hyperpersonalisiert. Es ist schlicht nicht mitteilbar und somit für die anderen nicht real. Das »Weh« eines Menschen, der vor Schmerz nur noch stammeln und schreien kann, soll irreal sein?