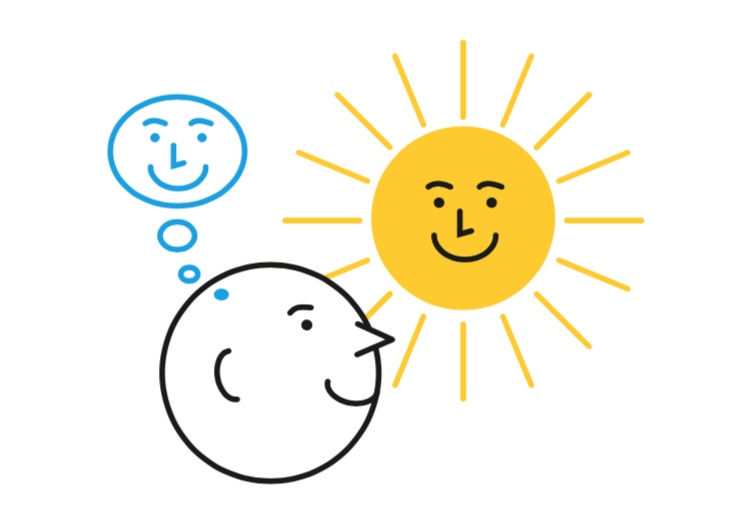»Liebe dich selbst, und alles wird gut« – diese Botschaft verbreitet die Ratgeberliteratur heute gern. Was aber ist »Selbstliebe«? Was unterscheidet sie von Selbstsucht? Was, wenn die allgemeinen Ratschläge zur Selbstliebe gar keine sind? Und vor allem: Liebe ich mich? Eine Selbstbefragung.
Text: Greta Lührs
Wir stehen in der Umkleidekabine, und meine Freundin bewundert sich selbst im Spiegel. Bewundert – ja wirklich! »Ich sehe so gut aus heute«, sagt sie, während sie sich selbst anlächelt. Meine erste Reaktion: wow! Das hört man nicht oft. Und gleichzeitig muss ich anerkennend nicken. Ich freue mich für sie. Und das sage ich ihr auch. »Ich habe da einfach Glück, ich fand mich selbst insgesamt schon immer richtig toll«, sagt sie, als wir uns auf den Heimweg machen. Und ich fange an, mich zu fragen: Darf man das, sich selbst lieben? Sollte man es vielleicht sogar viel mehr, wie es uns Lebensratgeber und die Yogalehrerin nahelegen? Und warum fühlt es sich zugleich unbehaglich an zu sagen, man liebe sich selbst?
Was bedeutet »Selbstliebe« überhaupt? Der Duden bietet mir eine fast tautologische Definition an: Selbstliebe sei die egozentrische Liebe zur eigenen Person. Egozentrisch, das beinhaltet bereits eine Wertung: Man stellt sich selbst in den Mittelpunkt und nicht seine Mitmenschen. Dabei heißt es doch in der Bibel, man solle seinen Nächsten lieben »wie sich selbst« – dort wird eine grundsätzliche Selbstliebe also nicht nur als natürliche Anlage vorausgesetzt, sondern dient sogar als Prüfstein für die Liebe zu anderen. Für mich heißt Selbstliebe im alltäglichen Gebrauch, dass ich mit mir selbst eher zufrieden bin als unzufrieden. Dass ich mich selbst annehme und nicht ablehne. Dass ich mich als Person vor Augen habe und sage: Ja, passt! Aber ebenso bedeutet es, dass ich mich um mich selbst kümmere, so wie ich mich um andere geliebte Personen kümmere. Selbstsorge, das meinte schon Platon, ist unmittelbar mit Selbstliebe verknüpft. Ich kann mich nicht lieben und dabei wie den letzten Dreck behandeln. Liebe ich mich selbst? Schwer zu sagen. Es ist ungewohnt, das auszusprechen, und fühlt sich fast nach etwas Verbotenem an. Ich mag manche Dinge mehr und manche weniger an mir, so wie es vermutlich den meisten geht. Andererseits kümmere ich mich schon darum, dass es mir gut geht. Doch wer tut das nicht?
Platon war zwar ein Befürworter der Selbstsorge, doch sah er die übermäßige Selbstliebe als größtes Manko des Menschen und als Wurzel allen Übels an.
Ist Selbstliebe überhaupt ein Ideal, das sich anzustreben lohnt? Zunächst ist Liebe ja immer gut. Wenn sich alle lieben und mit sich zufrieden sind, mehrt das die Liebe auf der Welt immens. »Love trumps hate« – »Liebe übertrumpft Hass«, steht gerade wieder allerorten auf Plakaten, um gegen einen gewissen Politiker zu demonstrieren, dessen Spezialität das Schüren von Hass zu sein scheint. Wer mit sich glücklich ist, kann auch anderen etwas gönnen und ist weniger neidisch auf des anderen Glück, Erfolg, Geld oder Partner, das leuchtet ein. Der Grund, warum mir mit diesem Begriff unbehaglich ist, liegt darin, dass Selbstliebe nur an einem Sweetspot, einer Art effektiven Zone, uneingeschränkt gut ist, nämlich dort, wo sie weder zu groß noch zu klein ist. Es ist super, wenn ich mich mag und selbstbewusst durchs Leben gehen kann. Schon allein, weil ich dann viel glücklicher bin, als wenn ich alles blöd finde, was ich bin und tue. Aber wenn ich mich nur noch um mich selbst sorge, fallen nicht nur andere Menschen hintenüber, sondern auch alles andere, wie die Gesellschaft oder die Umwelt. Außerdem könnte ich mich dann zu sehr idealisieren, wie man es ja auch manchmal bei anderen tut, wenn man frisch verliebt ist. Blickt man auf die Philosophiegeschichte, teilen diese Befürchtung so gut wie alle Philosophen. Platon war zwar ein Befürworter der Selbstsorge, doch sah er die übermäßige Selbstliebe als größtes Manko des Menschen und als Wurzel allen Übels an. Selbstverliebtheit, Selbstsucht, Egoismus und Co. sind die hässlichen Verwandten der Selbstliebe, viele bezeichnen sie sogar als übersteigerte Formen, die auf ein und dieselbe Anlage zur natürlichen Selbsterhaltung zurückgehen. Sofort denke ich an den mythischen, selbstverliebten Narziss, der an der Verzückung über sich selbst starb.
DABEI IST ES AUF GEWISSE WEISE selbstverständlich, dass ich zuerst an mich selbst denke, ja sogar denken muss, schließlich bin ich die einzige Person, für deren Leben ich voll und ganz verantwortlich bin – so sehen es auch die Existenzialisten, für deren Thesen ich viel übrig habe. Wenn ich mich nicht am Leben erhalte und mein Leben gestalte, wer dann? Selbstfürsorge ist die eigene Aufgabe. Wie oft bin ich genervt von jammernden Menschen, die die Schuld für ihr verkorkstes Leben ständig anderen und den widrigen Umständen zuschieben? »Dann ändere doch endlich etwas, kümmere dich um dein Leben!«, möchte ich da manchmal ausrufen. Und tue es natürlich nicht – aus Höflichkeit, einer dieser sozialen Tugenden, die uns gesellschaftsfähig machen. Von allen üblen Eigenschaften, die jemand haben kann, ist Selbstsucht eine der unsympathischsten: Wer nur an sich denkt, ist nicht gesellschaftsfähig, eine Schande für das Zoon politikon, den Menschen als soziales und politisches Wesen. Wahrscheinlich tue ich mich deshalb auch so schwer mit der offenen Liebeserklärung an mich selbst – ich möchte nicht selbstverliebt oder egoistisch sein. Schließlich ist Sozialverhalten etwas, ohne das man es im Leben nicht weit bringt. Das wurde mir bereits als Kind beigebracht, wenn meine Eltern oder Erziehungsberechtigte mahnten, Dinge mit der Schwester zu teilen oder im Kindergarten auch mal andere auf die Schaukel zu lassen. Wir alle lernen: Wer die Interessen der anderen berücksichtigt, sich brav hintenanstellt, auch mal etwas für andere tut, ist ein angenehmer Zeitgenosse. Der wird gemocht, mit dem spielt man gern und den lädt man zur Geburtstagsfeier ein. Doch Moment! Da haben wir es: Verhalten wir uns nur darum so nett und sozial, weil wir dabei an uns selbst denken? Sind wir nur darum freundlich und teilen mit anderen, weil wir geliebt werden und dazugehören möchten?
Der englische Staatstheoretiker und Philosoph Thomas Hobbes (1588–1679) war zum Beispiel dieser Ansicht und verwendete dafür die bekannte Formel, der Mensch sei dem Menschen ein Wolf. Hobbes meinte: Eigentlich will jeder das größte Stück vom Kuchen für sich und gibt nur dann etwas ab, wenn er dafür eine Gegenleistung erwarten kann. Und natürlich kann man in jeder Hilfeleistung einen Vorteil für sich selbst sehen, und sei es nur das wärmende Gefühl, ein guter Mensch zu sein. Dieses Gefühl, auch »Helper’s High« genannt, kenne ich auch. Kaum eine Frage ist in der Moraltheorie nebenbei so umstritten wie jene, ob es altruistisches Handeln gibt. Auch darüber, ob eine Handlung an moralischem Wert verliert, wenn man sie aus, wie Kant es formulierte, »versteckter Selbstliebe« begeht, scheiden sich die Geister. Doch wer vermag schon so genau zu sagen, ob man dem Obdachlosen Geld gibt, weil man ihm etwas Gutes tun möchte, oder ob man sich selbst damit gefallen möchte? Und selbst wenn Letzteres der Fall wäre, tut man nicht trotzdem etwas Gutes? Ich würde lieber in einer Welt leben, in der sich alle lieben, als in einer, in der Selbsthass regiert. Denn Hass ist von Grund auf destruktiv und taugt nicht zur Bildung einer glücklichen Gesellschaft. Sogar der nicht gerade als Menschenfreund bekannte Arthur Schopenhauer (1788–1860) bezeichnet Selbstliebe als Willen zum Dasein, ohne den man jeden Antrieb verlieren würde.
Wohin man auch blickt, sieht man Leute, die sich damit beschäftigen, was sie an sich und ihrem Leben verbessern könnten.
OBWOHL ES MOMENTE GIBT, in denen ich mir wünsche, ich wäre jemand anderes, oder ich wäre zumindest anders, als ich bin, ist Selbsthass ein sehr starkes Wort, das oft in pathologischen Zusammenhängen auftaucht und mit dem ich mich nicht identifizieren kann. Selbstkritisch zu sein bedeutet ja noch nicht, sich völlig abzulehnen oder sich sogar zu verachten, sich selbst jeglichen Respekt abzusprechen. Ich habe außerdem die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die mit sich sehr viele Probleme haben, viel weniger Kapazitäten für andere Menschen, Beziehungen und gesellschaftliches Engagement zur Verfügung haben als jene, die mit sich gut zurechtkommen. Letztlich zahlt sich ein gewisses Maß an Selbstliebe also für alle aus – wobei damit noch nicht gesagt ist, dass jedes sozialverträgliche Verhalten der Selbstliebe entspringen muss. Schaue ich mir meine Freundin an, so habe ich gar nicht das Gefühl, dass sie nur um sich selbst kreist und ihr andere egal sind. Dass Selbstliebe die Liebe zu anderen schmälert, gehört zu den Vorurteilen, die zum Beispiel der Psychologe Erich Fromm (1900–1980) zurückwies. Er glaubte sogar, man könne nur andere lieben, wenn man sich selbst liebt. Dennoch liegt die Vermutung nahe, dass die meisten Menschen nicht ausschließlich mit sich zufrieden sind, sonst wäre Selbstoptimierung kein so großer Trend. Wohin man auch blickt, sieht man Leute, die sich damit beschäftigen, was sie an sich und ihrem Leben verbessern könnten. Nicht zufällig fand mein eingangs beschriebenes Gespräch im Sportverein statt. Das ist, für sich genommen, auch weder schlimm noch neu. Seit es Menschen gibt, wollen sie die beste Version von sich selbst werden, schon die antiken Philosophen dachten darüber nach, wie man seine Talente entfalten und fördern kann, wie man tugendhafter wird, sich zu pflegen hat oder welchen Stellenwert man Ruhm und Ehre einräumen sollte.
»ÜBERALL FÜHLE ICH MEINE UNSICHERHEIT und meine Schwäche; von dem, was ich bin und was ich tue, kann nichts vor meiner Selbstkritik bestehen«, so herzergreifend schreibt der französische Philosoph Michel de Montaigne (1533–1592) über seine eigene Unzulänglichkeit. Dabei fiel auch schon Montaigne auf, dass er über sich selbst viel härter urteilt als über andere. Die Angst, sich selbst zu überschätzen, ist bei ihm viel größer als die, jemand anderen unangemessen zu idealisieren. Über die Fehler und Mängel anderer kann ich auch oft besser hinwegsehen als über meine eigenen. Damit bin ich in guter Gesellschaft: Es gibt Studien, nach denen 70 Prozent der Menschen am sogenannten Hochstapler-Syndrom leiden: Sie haben chronische Angst, als Hochstapler entlarvt zu werden, will heißen, jemand könnte aufdecken, dass sie für ihren Job eigentlich völlig ungeeignet und unqualifiziert sind und sich ihre Position unredlich erschlichen haben. Besonders Frauen sollen dazu neigen, ihren Erfolg dem Zufall oder besonderen Umständen zuzurechnen, anstatt davon überzeugt zu sein, dass sie ihn sich erarbeitet und somit auch verdient haben. Die Selbstzweifel gehen manchmal sogar so weit, dass man sich unbewusst sabotiert, also schlechtere Arbeit leistet, als man könnte. Wenn wir uns aber alle chronisch unterschätzen, uns ironisieren, wie Aristoteles es nannte, und viel zu selbstkritisch sind, wieso wird dann ständig davon gesprochen, wir würden im Zeitalter der Narzissten leben?
Es scheint völlig beliebig geworden zu sein, was man für sich tut:
Ob man sich Smoothies zubereitet, einen Burger gönnt, Yoga praktiziert oder eine Fernreise macht – alles wird unter Selbstsorge verbucht.
Vielleicht deswegen, weil Selbstsorge – laut Platon eine der wichtigsten Techniken, um ein tugendhafter und reflektierter Mensch zu werden – gerade so angesagt ist, dass der Eindruck entsteht, die Welt müsste inzwischen nur noch aus perfekten Menschen bestehen – bei der ganzen Sorge um sich. Es scheint allgemein üblich geworden zu sein, sich mehr um sich selbst zu kümmern als um irgendetwas anderes – und dies der Welt auch pausenlos unter die Nase zu reiben, zum Beispiel in sozialen Medien wie Instagram.
WIE EINE JOURNALISTIN im »Guardian« schreibt, ist es dazu völlig beliebig geworden, was man für sich tut: Ob man sich Smoothies zubereitet, einen Burger gönnt, Yoga praktiziert oder eine Fernreise macht – alles wird unter Selbstsorge verbucht. Fatalerweise begünstigen unangenehme Entwicklungen in der Politik den Rückzug in das eigene Wohlbefinden nur noch weiter. Angeblich stiegen die Google-Suchanfragen zu »self-care« in letzter Zeit stark an. Selbstsorge ist also keine Technik mehr, mit deren Hilfe man ein besseres Gesellschaftsmitglied wird, sondern Eskapismus.
Wenn ich mir die perfekt inszenierten Leben, die uns im Internet von Models, Schauspielern, Bloggern oder sonstigen hochprivilegierten Personen dargeboten werden, anschaue, fällt es mir auch nicht gerade leicht, mit dem, was ich habe, zufrieden zu sein. Dass gerade Bilderplattformen wie Instagram Narzissmus, Missgunst und Voyeurismus schüren, glaube ich gern. Doch was im Internet so mühelos und leicht aussieht, ist natürlich ein riesengroßer Fake und das Resultat harter Arbeit. Definitiv ist das Internet ein Ort der Selbstdarstellung. Ich muss mich selbst immer wieder dazu ermahnen, es auch genau so zu behandeln. Sonst komme ich mir auch schnell minderwertig vor. Doch gerade wenn ich an die Worte Montaignes denke, wird mir einmal mehr klar, dass selbstkritisches Denken und Unzufriedenheit mit sich keine Produkte der Digitalmoderne sind. Ebenso gab es schon immer Menschen, die nach außen sehr zufrieden wirken, obwohl sie innerlich mit sich hadern. Die größten Blender sind ja meist die unsichersten von allen. Doch selbst wenn alle Menschen so glücklich, schön und gesund wären, wie sie im Netz scheinen, was wäre denn so schlimm daran? Verschlechtert sich dadurch mein eigenes Leben? Es wird immer jemanden geben, der etwas besser kann als ich, der schöner ist, erfolgreicher, lustiger. Die Konsequenz dessen kann doch nicht sein, in Selbsthass zu versinken. Von dem dänischen Philosophen Søren Kierkegaard (1813–1855) stammt das bekannte Zitat, das Vergleichen mit anderen sei »das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit«. Wie recht er hat, ist mein erster Gedanke. Schauen wir lieber auf das, was wir haben, als auf das, was andere haben – immerhin ist jeder anders, das ist ja der Witz! Doch im zweiten Schritt fällt mir auf: Gerade philosophisch gesehen wäre es eine Katastrophe, sich einfach nicht mehr zu vergleichen. Nur im Vergleich mit anderen kann ich doch eine realistische Selbsteinschätzung gewinnen. Die antiken Philosophen betrachteten Selbsterkenntnis, vor allem die demütige Einsicht der eigenen Unzulänglichkeit, als elementaren Bestandteil von Selbstsorge. Wir erlangen also Selbsterkenntnis, indem wir über uns nachdenken. Und zwar nicht nur über uns als Einzelnen, sondern als Teil einer Gesellschaft. Wir brauchen andere nicht nur als Vorbild, um zu lernen und uns etwas abzuschauen, sondern auch, um uns von ihnen abzugrenzen und damit sie uns den Spiegel vorhalten. Sich zu vergleichen kann frustrieren, egal ob man sich wie Montaigne an Kollegen misst oder sich wie ich die tollen Urlaubsbilder von Freunden ansieht. Ohne Vergleich fehlt uns aber das Regulativ, uns selbst maßlos zu unter- oder überschätzen.
Entschlossen zu sein heißt, sich selbst zu lieben.
WÜRDE ICH ZUFRIEDEN durchs Leben gehen wollen, mit einem Selbstbild, das ich mir zusammengebastelt habe, das aber nichts mit der Realität zu tun hat? So eine naive Selbstliebe kommt mir wenig erstrebenswert vor. Auf Dauer kann das auch gar nicht funktionieren, weil ich unweigerlich mit dem Bild, das andere von mir haben, kollidieren würde. Da halte ich es dann doch lieber mit John Stuart Mill (1806–1873) und bin lieber ein unzufriedener Mensch als ein zufriedenes Schwein. Wenn Selbstliebe sich in Selbstsorge zeigt und wenn Selbstsorge bedeutet, sich auch kritisch zu hinterfragen, dann liebe ich mich schon selbst. Allerdings, und da kommt wieder der Narzissmus-Vorwurf ins Spiel: Auch Selbstsorge in Form von Reflexion kann man übertreiben, indem man ständig über sich nachgrübelt und sich andauernd infrage stellt. Wenn ich jede Sekunde meiner Freizeit meditiere, ist das ebenso egozentrisch, als wenn ich alle drei Minuten ein Selfie poste. Wie anfangs bemerkt, geht es auch hier offenbar um den Sweetspot, an dem ich neben Nabelschau noch etwas anderes tun kann. Zum Beispiel Freundschaften pflegen, die Oma besuchen oder mich sozial engagieren. Mein Punkt bleibt dennoch dieser: Selbstsorge, wenn wir sie richtig verstehen wollen, nämlich in ihrem ursprünglichen sokratischen Sinne, ist nicht gleichbedeutend mit der Frage, was man sich denn als Nächstes Gutes tun könnte. Es geht nicht nur um Schaumbäder, ein gutes Glas Wein und ein Wellness-Wochenende. Sondern darum, sich ernsthaft mit sich selbst und der Welt, in der man lebt, auseinanderzusetzen. Der US-amerikanische Philosoph Harry Frankfurt hat eine ganz ähnliche Auffassung von Selbstliebe. Diese bedeutet für ihn nicht, von einem Vergnügen zum anderen zu springen und jedem Impuls blind nachzugeben, sondern sie kann sich auch darin zeigen, sich Herausforderungen zu stellen. Laut Frankfurt geht es bei der Selbstliebe eben darum, sich selbst ernst zu nehmen, und das bedingt, herauszufinden, was meine wahren Interessen sind.
»ENTSCHLOSSEN ZU SEIN HEISST, sich selbst zu lieben«, meint Frankfurt. Das schließt gar nicht aus, sich auch mal für Schokolade zu entscheiden oder sich zu vergnügen. Aber Frankfurt meint eben, dass es Dinge gibt, die wir wirklich wollen, und andere Begehren, die rechts und links nebenher auftauchen. Und wenn wir uns wirklich um uns selbst kümmern wollen, und das tun wir seiner Meinung nach, indem wir uns selbst lieben, tun wir alles dafür, herauszufinden, was diese wahren Interessen sind – und verfolgen sie dann auch. So sehr ich Frankfurts Argumentation nachvollziehen kann, habe ich dennoch den Eindruck, dass er von einem ziemlich hochgesteckten Ideal spricht. Wie finde ich denn nun heraus, was ich wirklich will? Und wie viel muss ich mich um mich und meine Interessen kümmern und wie viel um andere? Womit kann ich zufrieden sein, und wo sollte ich noch mehr geben? Wie merke ich, dass ich mein wahres Interesse verfolge? Selbstliebe, so kommt es mir vor, ist nur ein Teil einer guten Beziehung zu sich selbst. Faktoren wie Selbstvertrauen oder der etwas sperrige Begriff Selbstwirksamkeit tragen, zumindest für mich, viel dazu bei, wie ich mich als Person sehe. Ich möchte mir etwas zutrauen können, mich als jemanden verstehen können, der etwas bewegen und verändern kann. Einen Hinweis möchte ich hier zu guter Letzt noch anbringen, weil ich ihn sehr bedenkenswert und dabei bestechend einfach finde. Er stammt von dem Rapper Ice Cube und lautet: »Check yourself before you wreck yourself.«