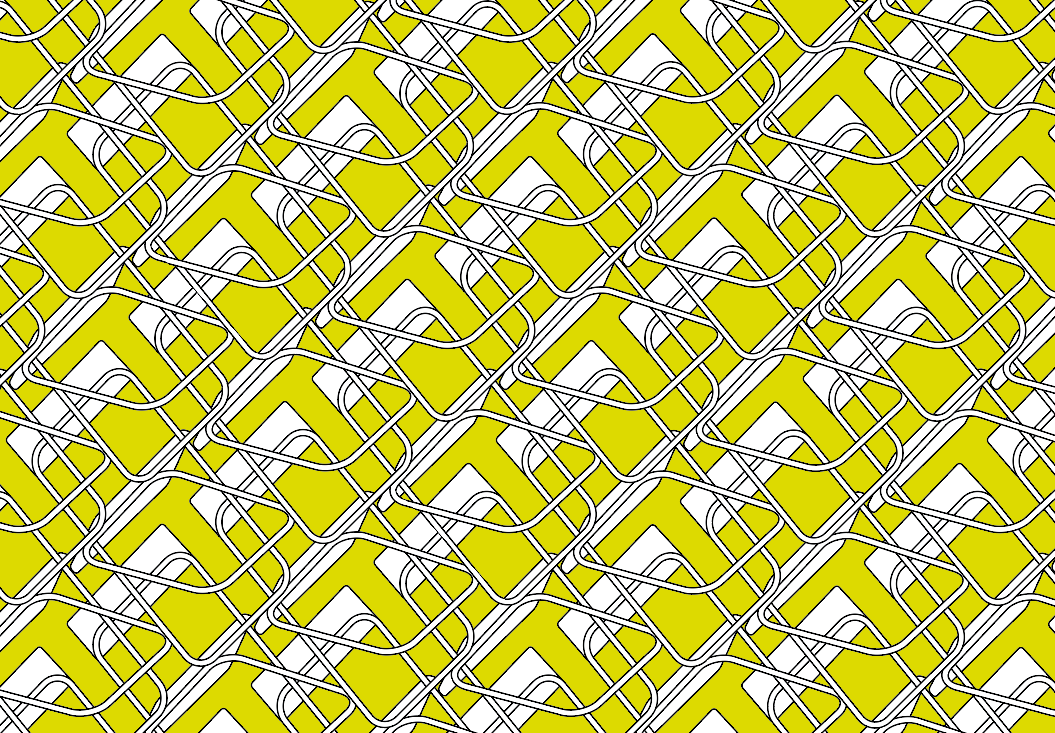Irgendwann trifft sie jeden – die Frage: Wie soll ich leben? Sie führt uns zur eigentlichen Aufgabe der Philosophie zurück: den Menschen beim Entwickeln einer praktischen Lebenskunst zu helfen.
Text: Rebekka Reinhard
Die Frage, wie man leben soll, damit die eigene Existenz Sinn hat, überfällt einen ohne Vorwarnung in der Spätpubertät – und lässt einen erstmals erkennen, dass Leben Selbstverantwortung bedeutet. Hat man sich von diesem Angriff halbwegs erholt, sucht man bei einer Person seines Vertrauens oder in der Weltliteratur nach Antworten. Nachdem man Franz Kafkas »Verwandlung« verwirrt beiseitegelegt hat, durchforstet man, einer spontanen Eingebung folgend, das Vorlesungsverzeichnis der philosophischen Fakultät. Seminarangebote wie »Essentialismus in der gegenwärtigen Metaphysik«, »Epistemologieals Bildkritik« oder »Kriterien der Theoriewahl« veranlassen einen dazu, dann doch lieber BWL zu studieren. Man geht ins Ausland, macht ein paar Praktika und landet mehr oder weniger zufällig bei einem Großkonzern. Man tippt, scrollt und telefoniert; hier ein Briefing, da ein Meeting, die Zeit vergeht wie im Flug. Man heiratet, bekommt ein Kind und glaubt sich angekommen. Doch plötzlich, zwischen zwei Anrufen, auf dem Weg in die Tiefgarage, schießt es einem wieder in Großbuchstaben durch den Kopf: »Was tue ich hier eigentlich? Was hat wirklich Sinn? Wie soll ich leben?«
IN EINER GESELLSCHAFT, die Vernunft mit Zweckrationalismus gleichsetzt und Lebenssinn mit Gewinn maximierung, sind diese Fragen relevanter denn je. Sie reißen uns aus der einlullenden Routine heraus und motivieren uns, das Leben nicht kurzfristig an Ziffern, Zeitfenstern und Zielvorgaben auszurichten, sondern es als einzigartiges Experiment zu betrachten, das glücken oder scheitern kann, dessen Ausgang wir aber jedenfalls aktiv mitbestimmen können. Einst war es Aufgabe der Philosophie, diesem Experiment zum Gelingen zu verhelfen. Für Sokrates, die Weisen des Hellenismus und der römischen Kaiserzeit war Philosophie kein Glasperlenspiel für Eingeweihte, sondern praktische Lebenskunst (techné tou biou), die dazu dienen sollte, die ungestalte menschliche Existenz in Form zu bringen: »So wie Holz das Material des Zimmermanns, Bronze das des Bildhauers ist, so ist das Material der Lebenskunst das Leben jedes Einzelnen«, meinte der Stoiker Epiktet (ca. 50 –125).
Lebenstraining, Instrument der Persönlichkeitsent wicklung, Selbstsorge (epimeleisthai sautou), permanente Übung (askesis) – das ist die Mainstream- Philosophie längst nicht mehr. Warum eigentlich nicht? Michel Foucault (1926 –1984) nennt zwei bedenkenswerte Gründe: einerseits das Aufkommen der christlichen »Bekenntnisreligion« in der Spätantike und die daraus hervorgegangene »Disziplinargesellschaft«, die Selbstsorge mit Selbstlosigkeit vertauscht habe; andererseits eine mit René Descartes (1596 –1650) einsetzende Entwicklung innerhalb der Philosophie, die das denkende Subjekt von der konkreten leiblichen Person und der materiellen Welt abtrennte. Spätestens seit Ende des 18. Jahrhunderts gilt die Philosophie als akademische Disziplin. Die heutige Moralphilosophie hat mit der Ethik des gelingenden Lebens kaum noch etwas zu tun. Sie ist die Domäne beamteter Fachleute, die in gut beheizten Hörsälen über Begründungen von Werturteilen, Güterabwägungen und moralische Dilemmata dozieren – eine zweifellos ehrbare
Beschäftigung. Doch, wie Ludwig Wittgenstein (1889 –1951) einmal in einem Brief bemerkte: »Was nützt es, Philosophie zu studieren, wenn alles, was es dir bringt, darin besteht, mit einiger Plausibilität über irgendwelche abstrusen Fragen der Logik etc. zu reden & wenn es dein Denken über die wichtigen Fragen des Alltags nicht verbessert, wenn es dich nicht gewissenhafter macht …«
Kein Wunder, dass Philosophie so ziemlich das Letzte ist, woran man denkt, wenn es einen nach grundsätzlicher lebenspraktischer Orientierung verlangt. Eher macht man Yoga. Eher sucht man einen Psychologen auf, eher lässt man seine grüblerische Anmutung als leichte bis mittelschwere Depression etikettieren. Dabei hat die Frage »Wie soll ich leben?« an sich nichts Pathologisches. Sie ist ganz einfach Teil der komplexen Suche nach dem Sinn, der Bedeutung und dem Wert unseres Lebens; einem existenziellen Bedürfnis, das sich spätestens dann bemerkbar macht, wenn das, was bisher selbstverständlich war, plötzlich infrage steht. Durch eine berufliche Veränderung, eine familiäre Krise oder eine Krankheit. Früher oder später machen wir alle die Erfahrung, dass das Leben gleichsam per definitionem unwägbar ist. Angesichts dessen sahen die antiken Philosophen das Geheimnis einer gelingenden – das heißt freien, aktiv gestalteten, moralisch guten und glücklichen – Existenz in der Fähigkeit des Menschen, wechselhaften Umständen mit einer festen inneren Haltung (ethos) zu begegnen. Einen solchen Ethos aber gibt es nicht auf Rezept – man kann ihn
nur durch Übung erwerben. Das Diktum »Alles ist Übung« (melete to pan) des Periandros, einem der Sieben Weisen aus der griechischen Antike, beherrscht die Lebenskunstphilosophie von der Antike bis zur (Post-)Moderne.
SO SEHR SICH UNSERE WELT von der Epiktets unterscheiden mag: Das Wesen des Menschen hat sich nicht verändert. Seine Unsicherheiten, Ängste, Sehnsüchte und Hoffnungen sind heftig wie eh und je. Daher sind die philoso phischen Übungsanleitungen nicht im Geringsten verstaubt. Sie bilden nicht nur die Grundlage der heutigen kognitiven Verhaltenstherapie und des modernen Coachings.
Sie fügen den Erkenntnissen von Psychologen auch noch eine entscheidende Dimension hinzu: Weisheit. Befreie dich von der mentalen Übersteigerung! Was uns stresst, ist nicht die Tatsache, dass wir lächerlich wenig verdienen oder dass das Verhältnis zu unserer Schwiegermutter einem kriegsähnlichen Zustand gleicht. Es ist einzig und allein unsere Vorstellung, die Dinge müssten so und nicht anders sein (nämlich so, wie wir sie gemäß unseren Zielen definiert haben!). Je krampfhafter wir daran festhalten, desto unfähiger werden wir, mit der Realität zurechtzukommen – die eben oft anderes im Sinn hat, als unseren Ideen zu entsprechen.
DIE BERÜHMTESTE PHILOSOPHISCHE Übung gegen mentale Übersteuerung ist die Skepsis (vom griechischen skepsis für »Betrachtung, Überlegung, Untersuchung«). Für uns ist Zweifeln eine Eigenschaft von Schwarzsehern – Pyrrhon von Elis (360 – 270 v. Chr.) sah darin den Königsweg zum gelungenen Leben. Die pyrrhonische Skepsis kreist um die Erkenntnis, dass man nichts, was einem im Leben begegnet, wirklich ernst nehmen muss, weil nichts wirklich sicher, real und wahrhaftig ist. Pyrrhons Meinung nach ist es völlig egal, ob wir CDU wählen oder die Piraten, ob wir in der Meditation unser Heil suchen oder im Investmentbanking, in der Philosophie oder in der Hirnforschung. Er pfeift auf sogenannte Werte und eine wie auch immer geartete Wahrheit über die Welt. Tatsächlich, so der Skeptiker, sind all unsere Werturteile nichts anderes als Behauptungen. Und gegen jede Behauptung lässt sich Widerspruch einlegen. Jedem »Gefällt mir!« entspricht ein »Gefällt mir nicht!«. Nichts ist schön oder hässlich, schmerzhaft oder angenehm, gut oder böse, wahr oder unwahr. Es scheint nur immer so oder so. Sogar Honig scheint nur süß zu schmecken. Wie er wirklich schmeckt, was er wirklich ist – jenseits unserer subjektiven, gewohnheitsmäßigen Wahrnehmung –, steht in den Sternen. Wenn uns aber die Beschaffenheit der Welt, wie sie wirklich ist, völlig unbekannt ist (da wir ja alles durch die menschliche Brille sehen), ist es sinnlos, sich an die »Wahrheit« einer bestimmten Überzeugung oder Konvention zu klammern. Denn alles, was »falsch« ist, kann aus einer anderen Perspektive »richtig« erscheinen – und umgekehrt. Angesichts dessen plädiert Pyrrhon für einen gewohnheitsmäßigen Denk- und Bewer tungsstopp: die Urteilsenthaltung (epoché). Werden wir unsere Zielvorgaben erreichen? Epoché! Wer hat recht, wer unrecht? Epoché! Geld oder Yoga? Epoché! Verabschieden wir uns also von dem Zwang, alles verstehen und im Griff haben zu müssen. Machen wir uns locker, tun wir einfach das, was ansteht – wie Pyrrhon, von dem Diogenes Laertios (ca. 3. Jhd. n. Chr.) einst schrieb: »Man erzählt sich, dass es [ihm] nichts ausmachte, Vögel oder Wildschweine selbst zum Markt zu tragen und zu verkaufen, genauso, wie er auch mit vollkommener Gleichgültigkeit regelmäßig die Hausarbeiten erledigte und sogar hin und wieder ein Schwein wusch.«
Sei nicht dort, wo du nicht bist! Das Leben rauscht wie ein Wasserfall an uns vorbei – unserem hyperaktiven Hirnkasten und unserer Vorliebe für Multitasking sei Dank. Die meisten Tage verabschieden sich grußlos, ohne dass wir ausgeschöpft hätten, was in ihnen liegt. Plötzlich sind wir 50 und fragen uns, wie es so weit kommen konnte …
DEN ANTIKEN LEBENSKUNSTPHILOSOPHEN war klar: Wer nicht achtsam mit seiner Zeit umgeht, verschenkt seinen größten Schatz. Denn das Leben befindet sich weder in der Zukunft noch in der Vergangenheit, sondern ausschließlich in diesem
Moment. Der Moment ist alles, was wir zum Leben brauchen. Wenn wir an dieser Stelle einwenden: Das genügt aber nicht!, vergessen wir, dass eine Minute mehr sein kann als sechzig Sekunden, ein Jahr mehr als 365 Tage – oder weniger. Ein Jahr, das in Termine und Stundenpläne eingeteilt wird, rauscht unbemerkt vorüber. Eines, das im jetzigen Moment gelebt wird, kann wie eine Ewigkeit scheinen. Ein einziger Augenblick ist fast nichts – und kann doch alles sein.
In diesem Sinne begriffen Epikur und der epikureische Dichter Horaz Philosophieren als eine Art Entspannungsübung. Bei Horaz’ Sentenz »carpe diem!« (»Pflücke den Tag!«) geht es darum, sich jetzt die Erlaubnis zu geben, die Arbeit zu unterbrechen, um ein Kind huckepack zu tragen oder dankbar einen Sonnenstrahl zu genießen – anstatt darauf zu hoffen, dass morgen alles besser wird. Denn das Leben ist eine äußerst zerbrechliche Angelegenheit, die, gerade weil sie so plötzlich zu Ende gehen kann, jederzeit, in jedem Augenblick einen absolut einzigartigen und unersetzlichen Wert besitzt. Mit anderen Worten: Es kommt immer weniger darauf an, dass wir irgendwann unsere Ziele erreichen (und folglich glücklich sind), als darauf, dass wir jetzt glücklich sind (während wir versuchen, unsere Ziele zu erreichen).
AUS SICHT DER STOIKER sind die tausend Aufgaben und Pflichten, die wir ständig als Ursachen für verhindertes Glück anführen – wechselweise der Job, der Partner, die Kinder, der Haushalt, der Streit mit den Nachbarn und die Urlaubsplanung –, nichts als Ausreden. Wie Seneca schreibt: »Neue Geschäfte werden sich immer und immer wieder einstellen: Wir säen sie geradezu, und aus jedem einzelnen entstehen mehrere. Außerdem billigen wir uns den Aufschub selbst zu: ›Habe ich das erst fertig, dann will ich mich mit allen Kräften darauf stürzen.‹« Ein gutes Leben zu wollen und es zu leben, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Das Leben ist zu kurz, um es aufzuschieben. Daran sollten wir denken, bevor wir anfangen zu klagen, wie schnell die Zeit vergeht. Gehe höflich mit deinen Krankheiten um! Wie die Endlichkeit des Lebens, so gelten auch Krankheiten heute als »No-Gos«. Leisten – nicht leiden – ist das Motto. Die Folge: Wenn es einen tatsächlich erwischt, ist man nicht vorbereitet. Man wirft sich mal wütend, mal panisch im Bett hin und her; ohne den geringsten Erfolg. Die Kunst des Krankseins war ein Spezialgebiet des Renaissance-Philosophen Michel de Montaigne (1533 –1592). Montaigne, der sich 1571 in einen Rundturm des Familienschlosses im südwest französischen Périgord zurückzog, um seine ganz eigene – von Pyrrhon, den Stoikern und den Epikureern inspirierte – Version der antiken Lebenskunst zu kreieren, litt seit seinem vierzigsten Lebensjahr unter Nierenkoliken. Erbrechen, Fieber und höllische Schmerzattacken zwangen ihn zu immer neuen, meist fruchtlosen Kuren. So wurde Montaigne nach und nach zu einem Profi im Umgang mit Krankheit. Er lehrt uns, dass es besser ist, Krankheiten höflich zu behandeln, statt sie zu verfluchen – und zwar, indem wir ihnen möglichst gelassen begegnen und ihnen genug Zeit geben, sich an uns auszutoben: »Wer sie mit herrischer Gewalt zu verkürzen sucht, verlängert und vermehrt sie; er fordert sie heraus, statt sie zu besänftigen«, schreibt er in seinen »Essais«.
Geduldigsein heißt für Montaigne nicht Selbstkasteiung. Keine Krankheit und kein Arzt der Welt können ihn dazu zwingen, auf Sparflamme zu leben. Der Philosoph warnt sogar vor allzu gewissenhaftem Gesundheitsmanagement. Wenn er Lust dazu hat, lässt er sich es lieber gut gehen, anstatt allzu strikt den ärztlichen Anweisungen zu folgen: »Mit einer Nierenkolik und gleichzeitig dem Verbot geschlagen zu sein, sich dem Genuss von Austern hinzugeben – das sind zwei Übel für eins.« Montaigne übte sich darin, die Bitterkeit des Krankseins genauso zu »probieren« (essayer) wie Rotwein, und den »Geschmack« (essai) des Leidens mit dem der Freude über die anschließende Genesung zu vergleichen. Das sollten wir auch tun. Denn was könnte befreiender sein als die Erkenntnis, dass krank und gesund zusammengehören – wie süß und sauer, Dur und Moll, hell und dunkel, weich und hart? Wie könnte man das eine ohne das andere je schätzen?
VERWECHSLE LIFESTYLE NICHT MIT LEBENSSTIL! Solange wir gesund sind, wollen wir von Krankheit nichts hören. Solange wir gesund sind, wollen wir uns
noch besser fühlen. Indem wir ein T-Shirt von Abercrombie & Fitch kaufen, einen ultrahippen Kronleuchter und anderes, was wir nicht brauchen. Wir schreiben Konsumobjekten eine quasigöttliche Aura zu, eine Schönheit, die dem glanzlosen Alltag fehlt.
Aber Schönheit kann viel mehr sein als das. Für Michel Foucault ist sie der Kern einer existenziellen Praxis – der Stilistik des Lebens –, durch die sich der Mensch als Künstler des eigenen Ichs beweist. Foucault beschreibt die philosophische Lebenskunst
als eine »Ästhetik der Existenz«, die nichts mit dem konformistischen Selbstkult und der zwanghaften Selbststilisierung unserer Tage zu tun hat, sondern für ein Lebensmodell der Offenheit und des Experiments steht. Wie Montaigne und die antiken Lebenskunstphilosophen sieht auch Foucault das Leben – sein Leben! – als Versuch (essai) oder lebenslange Übung in Freiheit an.
DER SCHLÜSSEL ZU WAHRER Souveränität ist für ihn nicht die Delphi’sche Maxime »Erkenne dich selbst!«, sondern der lebenskunstphilosophische Imperativ: »Sorge dich um dich selbst!« (um deine Gedanken, deine Seele, deinen Körper). Foucault ermutigt uns, die uralten stoischen »Selbsttechniken« oder »Praktiken der Befreiung« für unsere eigene Zeit neu zu entdecken: Die Praxis des Zuhörens, bei der man schweigend und
voller Respekt für die Logik des Gehörten seine Aufmerksamkeit trainiert; die Praxis des Schreibens, bei der man sich Notizen über Vergangenes macht, um daraus für die Zukunft zu lernen; die Meditation des Spazierengehens, bei der man seine jeweilige Reaktion auf unterschiedlichste Leute und Situationen prüft; die Sterbemeditation, bei der man sich vorstellt, ein einziger Tag käme einem ganzen Leben gleich (sodass man beim Aufwachen ein Baby ist und beim Zubettgehen ein Greis); u. a. Zusammengefasst heißt das: Stil hat nicht, wer sich an sein trendiges Smartphone klammert. Stil ist die Eigenschaft eines freien Menschen. Und frei werden kann man nur durch Training.
Wie soll man leben? Was ist richtig, was falsch? Niemand beherrscht das Leben aus dem Effeff. Wie ein Kunststück will es immer wieder geübt werden, mit Ernst und Heiterkeit – und einer Riesenportion (freiwilliger) Selbstdisziplin. Auch für die Lebenskunst des 21. Jahrhunderts gilt: Das ganze Geheimnis liegt im Üben.