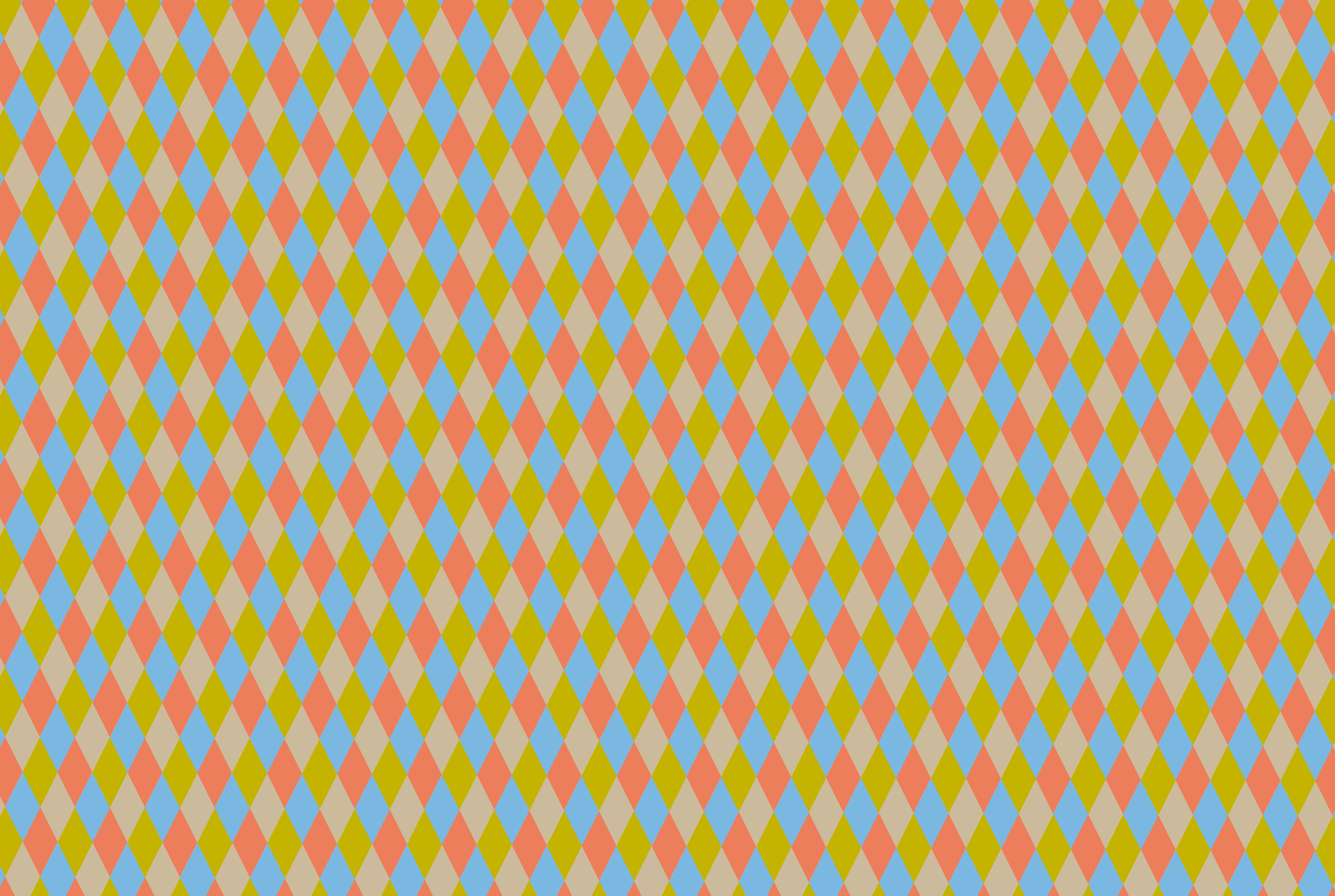Wir brauchen mehr Solidarität. Es gibt wohl kaum jemanden, der diesen Satz nicht unterschreiben würde. Aber was heißt es eigentlich, solidarisch zu sein? Und wo liegen die Grenzen der Verbundenheit?
Text: Robin Droemer und Greta Lührs
Vielen fällt bei dem Wort »Solidarität« zuallererst der Solidaritätszuschlag ein, andere denken an die Arbeiterparole »Hoch die internationale Solidarität!«. Im zwischenmenschlichen Bereich nennen wir jemanden solidarisch, der sich für die Belange anderer einsetzt – zum Beispiel für Flüchtlinge. Insofern sehen wir Solidarität als Tugend an. Dabei reicht manchmal bereits ein simpler Sprechakt. Als John F. Kennedy sagte, er sei ein Berliner, solidarisierte er sich mit den Bürgern West-Berlins. Als kürzlich ein Jugendlicher ein Video über die Folgen seines Mobbings ins Internet stellte, sprachen Zeitungen von »Wellen der Solidarität«, die dieses Video auslöste.Tausende bekundeten ihre Anteilnahme und lobten den Jungen für seine Offenheit. Die Ursprünge des Solidaritätsbegriffs reichen zwar zurück bis ins römische Recht, doch ihre politische Bedeutung gewann die Solidarität erst durch die Französische Revolution: Aus der Parole der Brüderlichkeit entwickelte sich bald die der Solidarité. Bis der Begriff allerdings auch im englischen und deutschen Sprachgebrauch Fuß fasste, dauerte es noch bis ins 19. Jahrhundert. Danach propagierten vor allem linke Gruppen die Solidarität im Sinne einer internationalen Arbeitersolidarität. Erst der erfolgreiche Kampf der polnischen Gewerkschaft Solidarnosc für Demokratie und Wandel im Ostblock beendete die Deutungshoheit der Kommunisten über den Begriff. Heute muss man weder links noch rechts sein, um sich zu verbünden – die Idee der Solidarität ist inzwischen mehrheitsfähig geworden. Aber was macht sie aus?
Sich zu solidarisieren ist zunächst eine Handlung, die sich an ein Gegenüber richtet. Ohne dass es jemand mitbekommt, kann es keine Solidarisierung geben – die private Beschäftigung mit einer Sache reicht nicht aus. Das liegt daran, dass Solidarität eine Art von Bekenntnis ist, die erst in der Öffentlichkeit wirksam wird. Indem wir uns solidarisieren, beziehen wir Stellung für oder gegen etwas. Dies kann ganz unterschiedlich aussehen: Man kann in einer Demonstration mitmarschieren, ein Foto im Internet posten, ein Symbol zur Schau tragen oder explizit seine Meinung sagen.
Nach dem Philosophen Andreas Wildt ist Solidarität »die Bereitschaft, sich für gemeinsame Ziele oder für Ziele anderer einzusetzen, die man als bedroht und gleichzeitig als wertvoll und legitim ansieht, besonders die Unterstützung eines Kampfes gegen Gefährdungen«. Solidarität ist also immer mit einem Einsatz für andere verknüpft. Bei diesen anderen handelt es sich meist um Gruppen oder Gemeinschaften, denen man sich in irgendeiner Weise verbunden fühlt. Man muss dafür den anderen nicht einmal persönlich kennen oder mögen. Es reicht bereits aus, gemeinsame Interessen zu hegen, um eine Solidargemeinschaft bilden zu können.
Solidarität bewegt sich also im Spannungsfeld zwischen Individuum und Kollektiv. Sie reicht über den bloßen Eigenvorteil hinaus. Damit ist sie eigentlich eine ungewöhnliche Stoßrichtung in modernen Gesellschaften, die seit der Aufklärung den Individualismus preisen: Selbstverwirklichung und Autonomie führen die Werteskala des modernen Menschen an. Bindungen und feste Strukturen stehen hingegen im Verdacht, die persönliche Freiheit einzuschränken, die als zentraler Wert liberaler Gesellschaften mit aller Macht verteidigt wird. Der Philosoph Jürgen Habermas konstatierte in einem Interview: »Wir mögen ja, jeder für sich, hochmoralische Wesen sein. Aber wie steht es mit dem kollektiven Handeln, dem gemeinsamen Engagement für die Abschaffung der Zustände, die zum Himmel schreien? Was schwindet, sind die Motive der Solidarität, von denen immer wieder soziale Bewegungen gezehrt haben.« Unsere Moral scheint zu enden, sobald wir etwas tun müssen, das nicht lediglich uns selbst nützt. In eine ähnliche Richtung geht die Gesellschaftskritik von Kommunitaristen wie Alasdair MacIntyre oder Michael J. Sandel: Der vom Liberalismus geprägten modernen Welt sei der Gemeinschaftssinn abhandengekommen. Anstatt auf Kooperation setzten Liberalisten auf Wettbewerb und freie Märkte, was zu einer Vereinzelung des Individuums führe. Der Kommunitarismus, der vor allem in den USA vertreten wird, fordert darum eine Rückkehr zu gemeinschaftlichen Werten. Eine seiner Grundannahmen ist, dass sich der Einzelne dann für das Gemeinwohl einsetzt, sich engagiert und an politischen Fragen partizipiert, wenn er sich einer Gemeinschaft zugehörig fühlt. Die Bande einer Gemeinschaft zu untersuchen, ist die Aufgabe der Soziologie. Somit ist es kaum verwunderlich, dass ihr französischer Gründervater Émile Durkheim (1858 –1917) als einer der Ersten das Phänomen genauer unter die Lupe nahm. Durkheim unterscheidet zunächst zwischen zwei Formen der Solidarität, der mechanischen und der organischen. Die mechanische Solidarität ergibt sich laut Durkheim primär aus den Merkmalen gemeinsamer Identität wie Traditionen, Kultur oder ähnlicher Kleidung und ist für vormoderne Gesellschaften charakteristisch, in denen es kaum Arbeitsteilung gibt. In einem Dorf in der Savanne machte es früher kaum einen Unterschied, wer die Ziegen hütete und wer das Wasser holte; tendenziell war jeder in der Lage, die Aufgabe eines anderen Stammesmitglieds zu übernehmen.
Moderne Gesellschaften sind jedoch vor allem auf organische Solidarität angewiesen. Der Grund dafür ist die weitreichende Arbeitsteilung. Fällt ein einzelner Teil der Gesellschaft aus, gefährdet das auch das Überleben der anderen. Wie die Organe eines Körpers übernimmt jeder Arbeiter eine für ihn zugeschnittene Aufgabe, die jedoch nur zum Gesamtwohl beiträgt, solange die anderen Teile ebenfalls funktionieren. Wenn die Spieler einer Fußballmannschaft sich gegen die Entlassung des Trainers stellen, halten sie zu ihm, damit er seinen Teil zum gemeinsamen Erfolg beiträgt – nicht etwa, weil er ihnen ähnlich wäre.
Laut Durkheim zeigen wir uns heutzutage also solidarisch, weil wir alle voneinander abhängig sind. Jemand anderem zu helfen bedeutet dann, sich indirekt selbst zu helfen. Folgt man dem deutschen Philosophen Ulrich Steinvorth, liegt Durkheim mit dieser These gleich doppelt daneben. Zunächst einmal verschiebt sich der Begriff der Solidarität so aus dem Bereich der Moral in den Bereich der Klugheit. Jegliche Verweigerung von Solidarität würde das eigene Wohl schädigen. Im Alltag sprechen wir jedoch vor allem von Solidarität, wenn man sich für andere einsetzt, nicht für sich selbst. Was jedoch noch schwerer wiegt, ist die soziale Realität.
Die Menschen in modernen Gesellschaften sind mitnichten so sehr voneinander abhängig wie die Organe eines Körpers – jedenfalls nicht zu gleichen Teilen. Dem Superreichen schadet es nicht, wenn er dem Hungerleidenden nicht hilft. Vielmehr ist dieser oft vom Besserverdiener abhängig, ohne dass dieses Verhältnis auch in die andere Richtung bestünde. Solidarität lässt sich also nur bedingt erklären, wenn man sie lediglich als soziales Bindemittel versteht. Schließlich werden moderne Gesellschaften noch von viel mehr zusammengehalten: Freundschaft, Vertrauen, Loyalität, Wohltätigkeit oder Gerechtigkeit spielen eine ebenso entscheidende Rolle. Solidarität kommt hingegen, wie der Philosoph Martin Hartmann meint, dort zum Tragen, wo es Ungerechtigkeiten gibt. So kann es sein, dass sich die unterschiedlichsten Menschen gegen ein Unrecht zusammenschließen, wenn sie ein gemeinsames Interesse haben. Dies kann durch ganz konkrete Vorkommnisse geschehen – wie nach dem Attentat auf die »Charlie Hebdo«-Redaktion. Oder durch ein grundlegendes Gefühl von Benachteiligung, etwa wenn man für mehr Rechte für Homosexuelle eintritt. Wichtig ist aber, dass die Betroffenen ihre Situation selbst als ungerecht wahrnehmen. Deswegen kann man sich auch nicht mit Tieren solidarisieren. Zwar haben Tiere Rechte, die verteidigt werden können, ein Rechtsempfinden jedoch fehlt ihnen.
Die Verbindung zur Gerechtigkeit unterscheidet Solidarität von anderen Sphären wie Loyalität oder Freundschaft. Man kann loyal zu seinem Kollegen stehen, wenn dieser wegen wiederholter Unpünktlichkeit entlassen wird. Man kann sich mit ihm solidarisieren, sollte er zu Unrecht beschuldigt werden, zu spät zu sein. Doch nicht nur die Dimension der Gerechtigkeit gehört zur Solidarität; sie ist vielmehr zu einem gewissen Grad immer auch altruistisch motiviert – schließlich soll anderen geholfen werden. Solidarität steht also auch mit der Idee der Wohltätigkeit in Verbindung.
Laut Steinvorth besteht der entscheidende Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Wohltätigkeit in ihrer Erzwingbarkeit. Rechte sollten im besten Fall erzwingbar sein, etwa indem man sie einklagt oder erkämpft. Auf Hilfeleistungen im Sinne der Wohltätigkeit hingegen besteht kein solcher Anspruch. Jeder darf Geld spenden, wenn er glaubt, etwas Wertvolles und Gutes damit zu tun. Niemand kann jedoch zu einer Spende gezwungen werden. Wie verhält es sich mit der Solidarität? Ist sie notwendigerweise freiwillig, oder kann man auch zu ihr gezwungen werden?
In Deutschland herrscht eine Krankenversicherungspflicht. Alle Mitglieder der Krankenkasse zahlen Beiträge, aus denen im Krankheitsfall die Ausgaben gedeckt werden. In einer Krankenkasse schließen sich Menschen mit dem gleichen Interesse, nämlich an Versorgung, zusammen. Wird jemand krank, stehen die anderen mit ihrem Geld für ihn ein, um sein Recht auf Gesundheit durchzusetzen. Offensichtlich handelt es sich bei einer Krankenversicherung um eine Vereinigung mit solidarischen Zügen. Trifft das aber noch zu, wenn die Mitglieder zum Beitritt gezwungen werden?
Steinvorth würde diese Frage bejahen. Seiner Ansicht nach ist Solidarität »in manchen Formen legitim erzwingbar, weil sie in manchen Formen ein Teil der Gerechtigkeit ist«. Damit eine Handlung überhaupt als solidarisch gilt, müssen ihre Adressaten in ihren Rechten verletzt oder bedroht worden sein. Diese Bedingung teilt sie mit der Gerechtigkeit, wodurch sie in manchen Fällen auch die Erzwingbarkeit teilt. Gesundheit etwa ist ein natürliches Gut, an dem jeder Mensch ein legitimes Interesse
hat. Wird ein Mensch krank, hat er ein Recht auf Hilfe, solange diese nicht in die Selbstbestimmung der Helfer eingreift. Eine gesetzliche Krankenversicherungspflicht kann also durchaus als eine erzwungene Form der Solidarität verstanden werden.
Nur unterscheidet sich diese Form der Solidarität von der früher erwähnten, die erst durch ein öffentliches Bekenntnis entsteht. Hier manifestiert sich Solidarität nicht als konkrete Handlung, sondern als Ideologie, die ein System, nämlich das der gegenseitigen Absicherung, begründet und legitimiert. Es existieren also unterschiedliche Begriffe von Solidarität. Das liegt vor allem daran, dass Solidarität zwischen verschiedenen moralischen Sphären oszilliert. Der Staat beruft sich auf
Solidarität in den Worten Habermas’ als »andere Gerechtigkeit«. Im Miteinander zwischen Individuen hingegen steht der Aspekt der Hilfe im Vordergrund. In Zeiten des Internets kostet Solidarität wenig. Es ist einfacher, etwas anzuklicken, als sich frühmorgens aus dem Bett zu schälen, um an einer Demonstration teilzunehmen. Ist die Netzsolidarität also nur eine »Light«-Variante der Solidarität? Ein »Gefällt mir« nützt einem Flüchtling nicht annähernd so viel wie kostenloser Deutschunterricht. Die Versuchung ist groß, in Internetsolidarität nur einen billigen Ablasshandel zu sehen. Man investiert wenig, erhält aber die Befriedigung, etwas Gutes getan zu haben. Auf der anderen Seite ist die Bekundung von Solidarität manchmal die einzige Möglichkeit, auf ein Unrecht zu reagieren. Nicht jeder kann nach Moskau fliegen und Pussy Riot aus dem Gefängnis befreien. Was man tun kann, ist öffentlich Stellung zu beziehen und damit zu zeigen: Dort geschieht ein Unrecht, das ich ablehne.
Habermas lobt am Internet ausdrücklich sein Potenzial, die deliberative Willensbildung zu fördern, die er als essenziell für eine funktionierende Demokratie ansieht. Auf jeden Fall ist eines nicht von der Hand zu weisen: Um sich solidarisch mit Menschen zu zeigen, denen Ungerechtigkeit widerfährt, muss man davon überhaupt erst mal etwas wissen. Das Internet ist ziemlich gut darin, Informationen zu verbreiten – auch solche, von denen es manchen vielleicht lieber wäre, wenn die Welt nicht davon erfahren würde. Durch Online-Petitionen hat zum Beispiel die Menschenrechtsorganisation Amnesty International schon kurzfristig geplante Hinrichtungen von politischen Aktivisten oder Ehebrecherinnen verhindern können. Die öffentliche Auspeitschung des saudischen Bloggers Raif Badawi wurde auf internationalen Protest hin fürs Erste gestoppt. In solchen Fällen kann solidarisches Verhalten also nicht nur das eigene Online- Profil aufwerten, indem es einem den Gutmenschen-Stempel aufdrückt, sondern tatsächlich etwas bewirken.
Wer sich solidarisiert, will helfen. Aber dies beschränkt sich auf Personen, denen ein
Unrecht geschieht und mit denen man ein gemeinsames Interesse teilt. Damit eine Solidargemeinschaft entsteht, muss man erkennen, dass man im selben Boot sitzt. Das birgt jedoch auch Gefahren: Solidarische Gefühle sind nicht per se gut, sie können umschlagen in Nationalismus, Ausgrenzung und Abwertung des Fremden und »Nichtdazugehörigen «, wie gerade das Beispiel der islamfeindlichen »Pegida« zeigt. Sich für oder gegen etwas auszusprechen beinhaltet meist, sich gleichzeitig von anderen abzugrenzen. Ganz lässt sich das kaum vermeiden: Die Gruppe der
»Erdenbürger«, wie der Philosoph Richard Rorty (1931–2007) meinte, ist zu abstrakt – Solidarität mit der gesamten Menschheit ist nicht möglich. Zumindest nicht, bis die ersten Außerirdischen auf unserem Planeten landen und uns ungerecht behandeln.
Das Ausgrenzungsmoment der Solidarität gehört daher stets kritisch untersucht, genauso wie ihre Bindung an ein Gefühl der Ungerechtigkeit, die die Solidarität anfällig macht für Missbrauch. Solidarität allein reicht nicht als sozialer Kitt. Die Absicht, die sie
vertritt, muss stets hinterfragt werden. Trotzdem gibt es Hoffnung – Solidarität bedeutet nicht nur Ausgrenzung, sondern auch Engagement. Wir brauchen sie auch heute noch, um diejenigen zu unterstützen, die Hilfe benötigen. Das Internet ist daher eine Chance für mehr Solidarität, weil es ganz unterschiedliche, einander fremde Menschen verbindet. Es entstehen neue Interessengemeinschaften, die zu Solidargemeinschaften werden können. Das Internet spannt neue Möglichkeiten der globalen Gruppenbildung auf, die sich überschneiden und verzweigen und vor allem: Staatsgrenzen transzendieren. Je mehr wir mit Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt kommen, desto eher kann sich ein Gefühl der Gemeinsamkeit einstellen. Wir sind nicht nur Bürger eines Staates, sondern haben viel mehr Facetten, Interessen und Wertvorstellungen. Wer nur auf das eigene Glück bedacht ist, wird sich kaum in sinnvoller Weise solidarisieren. Das Gemeinsame ist die Chance, den Individualismus zu überwinden und auch das Wohl anderer wichtig zu nehmen. Ein Solidaritätsbegriff, der in unsere Zeit passt, betont nicht das Ausgrenzende, sondern das Verbindende.