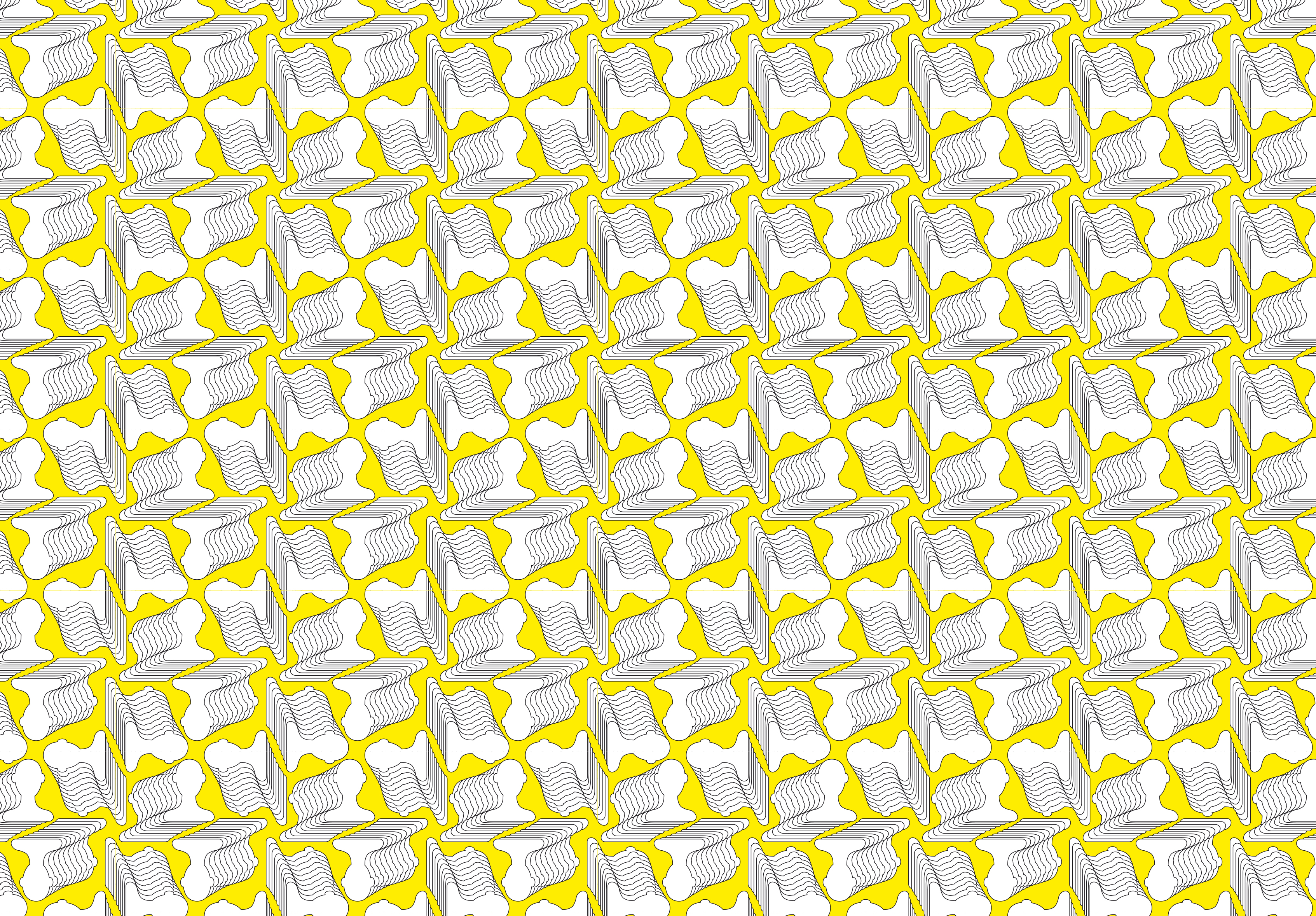Mit der Erfindung des Geldes wollte der Mensch einst den Tausch von Waren erleichtern. Mit einem rechnete er nicht: dass es ein Eigenleben entwickeln würde. Dass die Moneten zum Meister werden würden, die den Lauf der Welt diktieren – und die Menschen nicht nur dessen Diener, sondern in letzter Konsequenz sogar: überflüssig würden.
Text: Tobias Hürter und Thomas Vašek
Im Frühjahr 1827 ging es Ludwig van Beethoven gar nicht gut. Nachdem er viele Jahre lang großzügig dem billigen Weißwein zugesprochen hatte, zeigte der 56-Jährige nun schwere Symptome einer Leberzirrhose: Gelbsucht, Wasser in den Beinen und im Unterleib. Drei Operationen hatten ihn geschwächt. Um seine Lebensgeister wieder zu wecken, verschrieben die Ärzte ihm »Punsch-Eis in bedeutender Quantität täglich«. Zunächst schien es zu funktionieren: Beethoven konnte sogar wieder seinen Lesesessel beziehen. Er nahm Walter Scott zur Hand. Der Komponist schätzte den schottischen Nationaldichter, hatte sogar ein paar von dessen Texten vertont. Doch dieses Mal wollte Scott ihm nicht gefallen. Beethoven musste sich furchtbar aufregen.
»Der Kerl schreibt doch bloß fürs Geld!«, rief er und schleuderte den Band in die Ecke. Eine vierte Operation wurde notwendig. Nicht einmal das Punsch-Eis vermochte es mehr, den großen Komponisten bei Kräften zu halten. »Von hieran ging es nun rasch dem Tode zu«, schrieb Beethovens Sekretär und Biograf Anton Schindler. Na, und Sie, Herr Beethoven? Haben Sie etwa für lau komponiert? – Natürlich nicht. Als freischaffender Künstler musste Beethoven stets darauf achten, dass die Kohle stimmte. Aber er stellte die Kunst über das Geld. Als er einmal ein Oratorium zu einem Text von Joseph Carl Bernhard komponieren sollte, das mit einem großzügigen Honorar von 300 Dukaten entlohnt werden sollte, brach er die Arbeit ab und verzichtete auf das Geld, weil ihm der Text nicht passte. Walter Scott hätte vielleicht weiterkomponiert. Das ist es, was Beethoven an ihm missfiel.
Es ginge sicherlich zu weit zu sagen, dass Walter Scott Beethoven ins Grab gebracht habe. Er hat jedoch zumindest dazu beigetragen. Beethoven konnte nicht mehr erklären, was genau ihn an Scott so aufgebracht hatte. Aber wir können es vermuten. Beethoven sah den Wert von Scotts Werk durch den Verdacht beeinträchtigt, dass dieser nur dem Geld hinterhergeschrieben habe. Das Geld habe Scott korrumpiert, glaubte der Komponist. Wenn er recht hatte, dann verändert das Geld uns. Aber wie? Was macht es mit uns? »Geld regiert die Welt«, so sagt man. Und das ist sicherlich nicht übertrieben. Zwar gibt es Geld als Zahlungsmittel schon seit Jahrtausenden. Doch noch nie war es so mächtig wie heute. Tatsächlich durchdringt es fast alle Lebensbereiche. Mit Geld kann man so gut wie alles kaufen. Geld befreit von Zwängen. Es hilft, Bedürfnisse zu befriedigen. Es schafft Möglichkeiten. Insofern macht es frei. Aber in einem anderen Sinn kann es auch unfrei machen, nämlich dann, wenn es das Handeln diktiert. Viele Menschen empfinden heute Unbehagen über die Macht des Geldes – und über unser Wirtschaftssystem, das Geld zu einem Fetisch macht. Wir empören uns über aberwitzige Managergehälter und die haltlose Geldgier der Finanzbranche. Zugleich denken wohl die meisten von uns, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt als Geld. So sah es schon Aristoteles. Von ihm stammt die erste Theorie des Geldes – und die erste ökonomische Theorie überhaupt. Der griechische Philosoph geht dabei von den natürlichen Bedürfnissen des Menschen aus. Die Ökonomie ist für ihn eine Haushaltslehre (von oikos = Haus), das Ziel ist die Deckung des eigenen Bedarfs. Tauschhandel ist für Aristoteles in Ordnung, solange er der Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern dient. »Gewinnsüchtige Erwerbskunst« dagegen ist unnatürlich, weil sie die Gefahr in sich birgt, Reichtum um seiner selbst willen anzuhäufen. Gelderwerb ist für Aristoteles nur ein Mittel zum Zweck. Das Ziel des Menschen ist nicht Reichtum, sondern die Eudaimonia, das gelungene Leben. Wer genug Geld hat, um ein gutes Leben zu führen, der hat wirklich genug. Doch ohne diesen Maßstab gibt es keine Grenze, man will immer noch mehr.
Das Ziel des Menschen ist nicht Reichtum, sondern die Eudaimonia, das gelungene Leben. Wer genug Geld hat, um ein gutes Leben zu führen, der hat wirklich genug.
Auch heutige Ökonomen sehen Geld vor allem als Tausch- und Zahlungsmittel. Ohne Geld müssten wir Güter direkt tauschen. Statt die Brötchen beim Bäcker mit Euro zu bezahlen, müssten wir ihm dann irgendetwas mitbringen, das er als Äquivalent für seine Brötchen akzeptiert – und das wäre ziemlich mühsam. So gesehen treiben wir auch heute noch Tauschwirtschaft, und Geld ist dafür eben nur das effizienteste Mittel. Aber Geld ist viel mehr als nur ein Wertmaßstab. Es misst nicht einfach einen Wert, sondern Vertrauen. Wir akzeptieren Geld als Zahlungsmittel, weil wir denken, dass auch andere dies tun. Erst Geld ermöglicht es, Schulden exakt zu quantifizieren und auf andere zu übertragen. Das ist die Wurzel der Kreditund Bankenwirtschaft, ohne die Kapitalismus nicht möglich wäre. Aus dieser Sicht liegt der Ursprung des Kapitalismus nicht im Tausch, sondern letztlich im Geld. Etwas salopp könnte man sagen: Kapitalismus hat offenbar mit methodischer Geldvermehrung zu tun.
Primitive Formen der Marktwirtschaft gab es zwar schon lange vor dem Kapitalismus. Aber ihre Möglichkeiten waren beschränkt. Die Oikonomia des Aristoteles entsprach zwar dem tugendgemäßen Leben. Aber erst das Kapital befeuerte die wirtschaftliche Entwicklung, es brachte Fortschritt, Wohlstand und Wachstum.
Erste Ansätze des Kapitalismus finden sich schon in der späten Antike, schreibt der Sozialhistoriker Jürgen Kocka. Aufstrebende Großreiche wie China und Arabien brauchten damals Geld für Kriege, darum förderten sie den Handel. In Europa entwickelte sich der Handelskapitalismus erst im Mittelalter, zunächst vor allem in den italienischen Städten, wo die Kaufmannsfamilien gewaltige Vermögen anhäuften. Die Entstehung des Banken- und Kreditsystems erleichterte die Kapitalbeschaffung. Mit der Kolonialisierung expandierte der Handel zugleich in alle Welt, der Frühkapitalismus profitierte von den Plündereien in den Kolonien ebenso wie von der Sklaverei. Die gewaltige und teilweise gewalttätige Vermehrung des Kapitals, von Karl Marx (1818–1883) später als »ursprüngliche Akkumulation« bezeichnet, schuf die Grundlagen für den modernen Kapitalismus. Unter Kapital verstand man noch im 18. Jahrhundert schlicht Geld und sonstiges Vermögen, das nicht einfach nur gehortet, sondern gewinnträchtig angelegt wurde. Als »Kapitalist« galt ein vermögender Mann, der von den Zinsen leben konnte, das waren vor allem Kaufleute, Bankiers und Geldverleiher. Später drang das kaufmännische Kapital auch ins Handwerksgewerbe vor. Technische Neuerungen wie die Dampfmaschine führten schließlich zur Entstehung des Industriekapitalismus – und damit zu einem revolutionären Wandel, der die gesamte Gesellschaft erfasste. Die moderne Lohnarbeit entstand, Fabriken verdrängten das traditionelle Gewerbe. Das Kapital war in Bewegung, getrieben von seinem inhärenten Drang, sich selbst zu vermehren. Niemand hat die Widersprüche dieser Umwälzungen so dramatisch beschrieben wie Karl Marx. Einerseits schafft der Kapitalismus Fortschritt und Reichtum, andererseits führt er zu Ausbeutung und Elend. Das Wesen des Kapitalismus, so sah es Marx, besteht im Gegensatz zwischen Arbeit und Kapital. Das Kapital kann sich nämlich nur vermehren, indem es einen Teil des von den Arbeitern geschaffenen Wertes abschöpft, indem es also die Arbeiter ausbeutet. Und das führt nach Marx zu Klassenkämpfen, die den Kapitalismus schließlich in den Untergang treiben. Zur Zeit der industriellen Revolution war der Kapitaleigentümer meist selbst auch Unternehmer, und oft stammte das Kapital aus dem Familienkreis. An die Stelle der Familienunternehmer traten später die Manager, von denen man dachte, sie würden weniger soziale Rücksichten nehmen und sich stärker aufs Geschäft konzentrieren. Viele größere Unternehmen verwandelten sich in Kapitalgesellschaften, mit dem vorrangigen Ziel, die Rendite der Aktionäre zu maximieren, zugleich begann die Verflechtung zwischen Industrie- und Bankenkapital. Der moderne Finanzmarktkapitalismus befreite das Kapital schließlich von allen Fesseln. Im Finanzkapitalismus geht es nicht mehr um Produktion und Handel mit Gütern, sondern um Geschäfte, die mit dem Geld selbst gemacht werden, um noch mehr Geld zu verdienen. Die Geldvermehrung wird zum Selbstzweck – zu jenem Streben nach unbegrenztem Reichtum, vor dem Aristoteles gewarnt hatte.
Klassenkämpfe würden
den Kapitalismus in
den Untergang treiben,
hoffte Karl Marx.
Seit der Globalisierung der Finanzmärkte fließen immer gewaltigere Kapitalströme zwischen Ländern und Regionen. Das Geld geht dabei stets dorthin, wo es sich am schnellsten vermehren kann, wo die Rendite am größten ist. Der Finanzkapitalismus ist zu einer Art Spiel für Zocker geworden – getrieben von der Gier nach dem maximalen Gewinn. Nirgendwo wird das sinnfälliger als an den Börsen, wo automatisierte Handelssysteme heute binnen Sekunden Milliardentransaktionen abwickeln. Es ist das Zeitalter des »Turbokapitalismus«, der »Heuschrecken-Investoren« und des »Informationskapitalismus«, in dem Netzkonzerne selbst unsere persönlichen Daten in
Milliardenprofite verwandeln. Das klingt bedrohlich. Aber was genau ist schlecht am Kapitalismus, an der Herrschaft des Geldes, die immer mehr unser Leben bestimmt?
Für eine moralische Kritik am Kapitalismus gibt es im Wesentlichen zwei Ansatzpunkte. Erstens könnte man argumentieren, dass der Kapitalismus zu Ungleichheit führt, zu einer wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich. Dann muss man aber zeigen können, dass Ungleichheit schlecht ist. Zweitens ließe sich im Geiste von Aristoteles kritisieren, dass der Kapitalismus eine Lebensform hervorbringt, die mit einem guten Leben nicht vereinbar ist. Aus dieser Sicht korrumpiert die kapitalistische Ökonomie unsere Werte, indem sie alles in Waren verwandelt – und uns selbst in Egoisten, die nur den eigenen materiellen Vorteil suchen. Auch diese Sicht bedarf einer sorgfältigen Begründung. Beide Formen der Kritik, so glauben wir, hängen untrennbar zusammen. Kapitalismuskritik wird falsch, wenn sie nur einen der beiden Aspekte ins Auge fasst. Was beide miteinander verbindet, ist die Kritik am schrankenlosen Gewinnstreben, das keine moralischen Rücksichten nimmt.
Gerade in letzter Zeit, im Nachklang der großen Finanzkrise des Jahres 2008, gibt es eine Welle der Kritik am Kapitalismus. Ihre Galionsfigur ist der französische Ökonom Thomas Piketty. Die Erträge aus Kapitalbesitz wachsen seit Jahren stärker als die Wirtschaft, so lautet die zentrale These seines Buches »Kapital im 21. Jahrhundert« – und dadurch verschärft sich die Ungleichheit: Die Reichen werden immer reicher, während die Mehrheit abgehängt wird. Besonders in England und in den USA ist eine heftige Debatte über Piketty entbrannt. Kritiker werfen dem Ökonom sachliche Fehler vor. Verteidiger werfen den Kritikern sachliche Fehler vor. Auch wenn man Pikettys Analyse bezweifelt, niemand bestreitet ernsthaft, dass die kapitalistische Marktwirtschaft Ungleichheit produziert. Die philosophische Frage allerdings lautet: Wie ist diese Ungleichheit in moralischethischer Hinsicht zu bewerten? Märkte produzieren Ungleichheit, weil der Wettbewerb eben ungleiche Ergebnisse hervorbringt. Es gibt Gewinner und Verlierer, das leugneten nicht einmal Neoliberale wie der österreichische Ökonom und Sozialphilosoph Friedrich August von Hayek (1899–1992). Aus der Sicht der Neoliberalen hat das aber nichts mit sozialer Ungerechtigkeit zu tun. Marktprozesse sind eben unvorhersagbar, insofern sind sie weder gerecht noch ungerecht. In gewissem Sinne wirken sie sogar egalitär, weil sie alle gleich behandeln, ohne Ansehen der Person. Solange kein Zwang ausgeübt wird, bekommt jeder seine Chance. Viele Kapitalismuskritiker bestreiten jedoch diese Sicht.
Märkte reagieren auf Nachfrage, nicht auf Bedürfnisse. Daher führen sie zu Ungleichheit, wenn nicht alle Menschen die Güter bekommen, die sie für ihr Wohlergehen brauchen – etwa wenn die Mietpreise so hoch sind, dass sich Geringverdiener keine Wohnung leisten können. Insofern können Märkte ungerecht sein und Menschen Schaden zufügen. Märkte sind keine »spontanen Ordnungen«, wie Hayek dachte. Sie sind politische Institutionen, in denen jene, die über mehr Ressourcen verfügen, einen Machtvorteil gegenüber anderen haben. Die einen können bestimmen, welche Zeitungen die anderen lesen, welche Jobs und welche Wohnungen sie kriegen. Und das reproduziert die Ungleichheit. Ökonomische Ungleichheit kann die Fairness wichtiger Institutionen aushöhlen. Zum Beispiel die Ausgewogenheit des politischen Systems. Ebenso untergräbt ökonomische Ungleichheit die Fairness der Bildungschancen. Kinder von Reichen haben einen viel besseren Zugang zu guter Schulund Universitätsbildung – daher auch viel bessere Chancen auf ökonomischen Erfolg.
Ungleichheit ist falsch, dazu haben die meisten Menschen eine klare Intuition. Aber es ist gar nicht so einfach, diese Intuition rational zu begründen. Vereinfachen wir dazu die Dinge. Stellen wir uns vor, es gäbe zwei Gruppen von Menschen. Die aus der ersten Gruppe haben ein Vermögen von tausend Euro; die aus der zweiten Gruppe besitzen je eine Million. Nun könnte man Gleichheit herstellen, indem man das Vermögen der Millionäre auf je tausend Euro reduziert. Aber es wäre keine gute Tat. Man würde Menschen enteignen. Nach der gleichen Logik könnte man auch allen das Geld wegnehmen. Auch dann hätten alle gleich viel. Allerdings hätte dann niemand etwas. Es gibt durchaus Gründe, sich daran zu stören, dass manche Menschen mehr als andere haben. Einer der Gründe könnte sein, dass uns daran liegt, die Situation der Armen zu verbessern, indem wir Vermögen von den Reichen umverteilen. Das ist jedoch kein Argument gegen Ungleichheit an sich, sondern nur ein Argument dafür, den Armen zu helfen. Stellen wir uns vor, wir müssten einen Kuchen unter zehn Personen aufteilen. Intuitiv würden wir sagen, dass jede Person ein gleich großes Stück bekommen soll. Es sei denn, es sprechen besondere Gründe für eine Ungleichverteilung – etwa weil eine der Personen besonders großen Hunger hat. Gleichverteilung wäre also der Normalfall, jede Abweichung davon müsste gerechtfertigt werden. Das klingt nach einem ziemlich vernünftigen Prinzip. Die Frage ist allerdings, warum es uns überhaupt kümmern soll, dass andere ein größeres Stück abbekommen.
Der Kapitalismus verzerrt unsere Werte.
Er fördert unsere Gier und verleitet uns dazu,
die falschen Dinge wichtig zu nehmen.
Einige Moralphilosophen behaupten sogar, dass Gerechtigkeit mit Gleichheit im Grunde gar nichts zu tun hat. Nach der Auffassung dieser »Anti-Egalitaristen« ist Gleichheit allenfalls ein Nebenprodukt von Gerechtigkeit, aber nicht ihr eigentliches Ziel. Der amerikanische Philosoph Harry Frankfurt geht sogar noch weiter. Aus seiner Sicht ist Gleichheit nicht einmal in sich moralisch wertvoll: »Es kommt darauf an, ob Menschen ein gutes Leben führen, und nicht, wie deren Leben relativ zu dem Leben anderer steht.« Wer in bitterer Armut lebt, verdient demnach unsere Hilfe, weil Armut schlecht ist – und nicht deshalb, weil es anderen besser geht. Der Vergleich mit anderen spielt dabei zunächst einmal gar keine Rolle. Gerechtigkeit zielt nach Frankfurt nicht auf Gleichheit, sondern auf Achtung – und damit letztlich darauf, jedem Menschen »gerecht« zu werden. Die Menschen sind eben verschieden. Fundamental ist die Achtung, nicht die Gleichheit.
Wenn wir auf Gleichheit bestehen, orientierenwir uns an den Lebensumständen anderer, statt an unseren eigenen, sagt Frankfurt. Wir verfolgen also ein Ziel, das womöglich gar nicht zu unseren Bedürfnissen und Wünschen passt. Das Verlangen nach Gleichheit entfremdet Menschen daher von sich selbst und ihren eigenen Projekten. Es verleitet uns dazu, ein unauthentisches Leben anzustreben. Statt nach dem zu verlangen, was andere haben, sollten wir uns demnach lieber fragen, was für uns selbst gut ist. Im Geiste Frankfurts könnte man es vielleicht auch so sehen: Es ist zweifellos ein Defizit des Kapitalismus, dass er Ungleichheit hervorbringt. Aber dieses Defizit versteht man nur dann richtig, wenn man es im Kontext des guten Lebens betrachtet. Der Kapitalismus verzerrt unsere Werte. Er fördert unsere Gier und verleitet uns dazu, die falschen Dinge wichtig zu nehmen, indem wir uns etwa daran orientieren, was andere haben. Aber wenn wir Gerechtigkeit nur daran messen, begehen wir den gleichen Fehler, der normalerweise den Kapitalisten vorgeworfen wird: Wir nehmen das Geld zu wichtig. Was geschieht, wenn etwas »auf den Markt kommt«? Es bekommt einen Preis. Man kann es mit Geld bezahlen. Sonst nicht viel, möchte man zunächst meinen, es selbst bleibt, was es war. Bleibt es aber nicht. Es wird zur Ware. Für manche Dinge ist das eine nicht hinnehmbare Degradierung. Wenn ein Mensch zur Ware wird, dann wird er zum Sklaven. Niemand – zumindest so gut wie niemand – möchte seine Kinder zur Ware machen. Käuflicher Sex ist Ware, daher sind manche Menschen gegen Prostitution. Wohnungen werden durch den Wohnungsmarkt zu Spekulationsobjekten. Kommodifizierung, also die Verwandlung von Gütern in Waren, ist Degradierung – das ist der Grund, weshalb der
amerikanische Philosoph Michael Sandel fordert, den Märkten Grenzen zu setzen. Die These als solche ist nicht neu. Schon Marxisten wie Georg Lukács (1885–1971) sprachen von »Verdinglichung«. Jürgen Habermas warnt vor der »Kolonialisierung der Lebenswelt«. Und der amerikanische Kommunitarist Michael Walzer meint, dass bestimmte Werte vor dem »Marktimperialismus« geschützt werden müssten. Sie alle meinen im Wesentlichen etwas ähnliches: Der Markt untergräbt die Moral. Er korrumpiert bestimmte Werte, indem er sie dem ökonomischen Kalkül unterwirft. Allerdings kann man sich fragen, ob »Kommodifizierung« wirklich immer schädlich ist. Dass etwas einen Preis hat, heißt noch nicht, dass es uns nichts wert ist. Wir schließen ja auch Versicherungen ab für Werte, die eigentlich unbezahlbar sind. Gleichwohl gibt es Bereiche, die wir vor dem Markt schützen müssen. Die Aushöhlung der Werte und die Ungleichheit hängen zusammen. Marktmechanismen können moralische Normen untergraben – und zugleich dazu führen, dass nicht alle Menschen die Güter bekommen, auf die sie dringend angewiesen sind. Nehmen wir das Beispiel der medizinischen Versorgung. Ökonomisches Effizienzdenken kann das Ethos von Ärzten unterminieren. Zugleich bekommt jemand womöglich nicht die beste Behandlung, weil er sie sich nicht leisten kann. Beides zusammen zerstört in letzter Konsequenz die moralischen Grundlagen des Gesundheitssystems.
Moral ist üblicherweise keine Sache der Ökonomen. Sie pflegen nicht zu fragen, ob es in Ordnung ist, dass etwas als Ware gehandelt wird, sondern nur: »Quanto costa?« »Die meisten Ökonomen ziehen es vor, sich nicht mit moralischen Fragen zu beschäftigen«, schreibt Michael Sandel in seinem Buch »What Money Can’t Buy«. Und weiter: »Sie sagen, ihr Job sei es, das Verhalten zu erklären, nicht zu bewerten.« Friedrich August von Hayek hielt die Wirkung von Werten sogar für markthemmend. Sie störe das freie Spiel von Angebot und Nachfrage, glaubte der Ökonom und Sozialphilosoph.
Aber seit Hayeks Zeiten hat sich viel verändert. Das Marktdenken durchdringt inzwischen so gut wie alle Lebensbereiche. Manche Ökonomen, unter ihnen der Amerikaner Gary Becker, wollen das gesamte menschliche Handeln ökonomisch erklären. Wenn etwa jemand heiratet, dann nach Becker nur deshalb, weil er sich davon größeren Nutzen verspricht als davon, ledig zu bleiben. Wenn er sich scheiden lässt, dann nur, weil er die Mühen der Ehe für noch höher taxiert als den Aufwand eines Scheidungsverfahrens. Treffen Menschen wirklich auf diese Weise ihre Lebensentscheidungen – als innere Buchhalter? Es ist ziemlich kontraintuitiv. Ja klar, sagt Gary Becker, wir bemerken es eben nicht. Wir seien unbewusste innere Buchhalter. Ob das stimmt oder nicht – es ist schwer zu widerlegen.
Heute benutzen die großen Netzkonzerne solche ökonomischen Modelle, um das Verhalten ihrer Nutzer vorherzusagen. Dazu werten Computeralgorithmen unsere Suchanfragen oder bisherigen Einkäufe aus, in der Annahme, dass wir darin unsere Interessen, Wünsche und Präferenzen offenbaren. Aus Abertausenden Korrelationen zwischen den Daten berechnen sie, was ein egoistisches rationales Subjekt, ein Homo oeconomicus, höchstwahrscheinlich als Nächstes kaufen wird. Das Ziel ist, zu wissen, was wir noch nicht einmal selbst wissen. Das Modell des Homo oeconomicus aber verkürzt menschliches Verhalten um wesentliche Dimensionen, wie etwa Ethik und Moral. Das Problem daran ist, dass die ökonomischen Modelle menschliches Verhalten nicht nur beschreiben. Sie wirken auch normativ. Indem sie von der Annahme ökonomisch rationalen Verhaltens ausgehen, schreiben sie uns auch ein solches Verhalten vor. Wenn man etwa einen Kredit nur bekommt, weil ein Algorithmus unser Verhalten auf bestimmte Weise einstuft, dann können wir gar nicht umhin, uns nach diesem Modell zu verhalten, wenn wir den Kredit haben wollen. Die Gefahr liegt darin, dass die ökonomische Rationalität, eingeschrieben in immer leistungsfähigere Algorithmen, die Macht über unsere Köpfe übernimmt, ohne dass wir das überhaupt bemerken. Im Netzzeitalter gewinnt das Kapital seine bislang abstrakteste Gestalt. Die Algorithmen verwandeln unsere Wünsche, Werte und Interessen in berechenbare Datenströme – und am Ende wieder zurück in Geld. Die Dystopie ist der vollkommen ausrechenbare Mensch, der sich genau so verhält, wie es die Algorithmen vorhergesagt haben – von den Konzernen ferngesteuert und dazu abgerichtet, immer nur egoistisch den eigenen Nutzen zu maximieren. Das wäre genau unser monströser »Doppelgänger«, wie ihn der verstorbene »FAZ«-Herausgeber Frank Schirrmacher in seinem Buch »Ego« beschrieben hat. Ein ökonomischer Zombie – der ultimative Traum des Kapitals. Das wäre nicht nur die Ausschaltung des freien Marktes, sondern die ultimative Erniedrigung des Menschen. Doch so weit muss es nicht kommen. Es gibt auch den Weg zu einer anderen, menschlicheren Ökonomie, die nicht auf Maximierung aus ist, auf immer weitere Geldvermehrung, sondern auf das gute Leben der Menschen.
Im Netz gewinnt das Kapital seine bislang
abstrakteste Gestalt. Algorithmen verwandeln
unsere persönlichen Daten in Geld.
Wie viel ist genug?« Diese Frage ist der Titel eines Buches von Robert und Edward Skidelsky. Das Werk des Wirtschaftshistorikers und seines Sohnes, eines Philosophen, kann gelesen werden als ein Versuch, im 21. Jahrhundert die Bedingungen für ein im aristotelischen Sinn geglücktes Leben zu schaffen. Dabei empfehlen sie eine Rückbesinnung auf die alten aristotelischen Werte, auf Tugend und Maß. Die Politik muss nachhelfen, etwa mit radikalen Einschränkungen für Werbung und Luxusgüter, um den Konsumdruck zu senken. Es wird Zeit für eine neue Ökonomie im aristotelischen Sinn. Die Macht des Geldes über die Menschen muss gezügelt werden, und zwar auf zwei Ebenen: Auf individueller Ebene muss jeder sein Maß finden – wie viel Geld ist genug für mich? Auf kollektiver Ebene muss der Markt zurück in seine Schranken gewiesen werden. Wo er segensreich ist, sollen seine Kräfte frei wirken dürfen. Wo er unsere Werte korrumpiert, muss er weichen. Aus guten Gründen ist etwa der freie Organhandel nicht erlaubt, obwohl viele schwer kranke Menschen sicherlich bereit wären, für ein Spenderorgan zu bezahlen. Aber auch in anderen Bereichen, vom Wohnungsmarkt über das Bildungs- bis zum Gesundheitswesen, müssen wir den Markt zähmen. Markt und Moral stehen allerdings in keinem grundsätzlichen Widerspruch. Das sah schon Adam Smith (1723–1790), der ebenso Ökonom wie Moralphilosoph war. Zwar glaubte er, dass das wirtschaftliche Handeln von Eigeninteresse bestimmt wird. Aber zugleich stehen Marktteilnehmer in sozialen Beziehungen, die wechselseitiges »Mitgefühl« erfordern. Wer mit einem anderen lukrative Geschäfte macht, hat Interesse an einer vertrauensvollen Beziehung, schließlich will er die Geschäfte ja weiterhin machen.
Der Soziologe Georg Simmel (1858–1918) sah zwar die entfremdende Wirkung des Geldes. Zugleich hielt er aber den Markt für eine Institution, die soziale Bindungen zwischen den Menschen stärkt und damit die Gesellschaft zusammenhält. Man muss den Markt also nicht grundsätzlich verdammen, wenn man die Macht des Geldes zügeln will. Allerdings müssen wir dem Markt Grenzen ziehen, weil er sonst zu Ungerechtigkeit führt und in Bereiche eindringt, in denen er nichts verloren hat.
Schlecht ist nicht der Markt an sich. Schlecht ist das grenzenlose Gewinnstreben um seiner selbst wegen. Schlecht ist ein Kapitalismus ohne Moral. In einer Gesellschaft, die alles menschliche Handeln auf ökonomische Berechnung reduziert, können am Ende nur noch die Computer und Algorithmen Geschäfte machen – mit seelenlosen Zombies, die sich genau so verhalten, wie es die ökonomischen Modelle erwarten. Genau deshalb ist die Auseinandersetzung mit der Macht der Netzkonzerne so wichtig. Wenn sich die Algorithmen von den Menschen abkoppeln, dann laufen wir Gefahr, dass der Kapitalismus ohne uns weiterläuft. Dann vermehrt sich am Ende nur noch das Geld. Die ultimative Akkumulation des Kapitals braucht keine Menschen mehr.