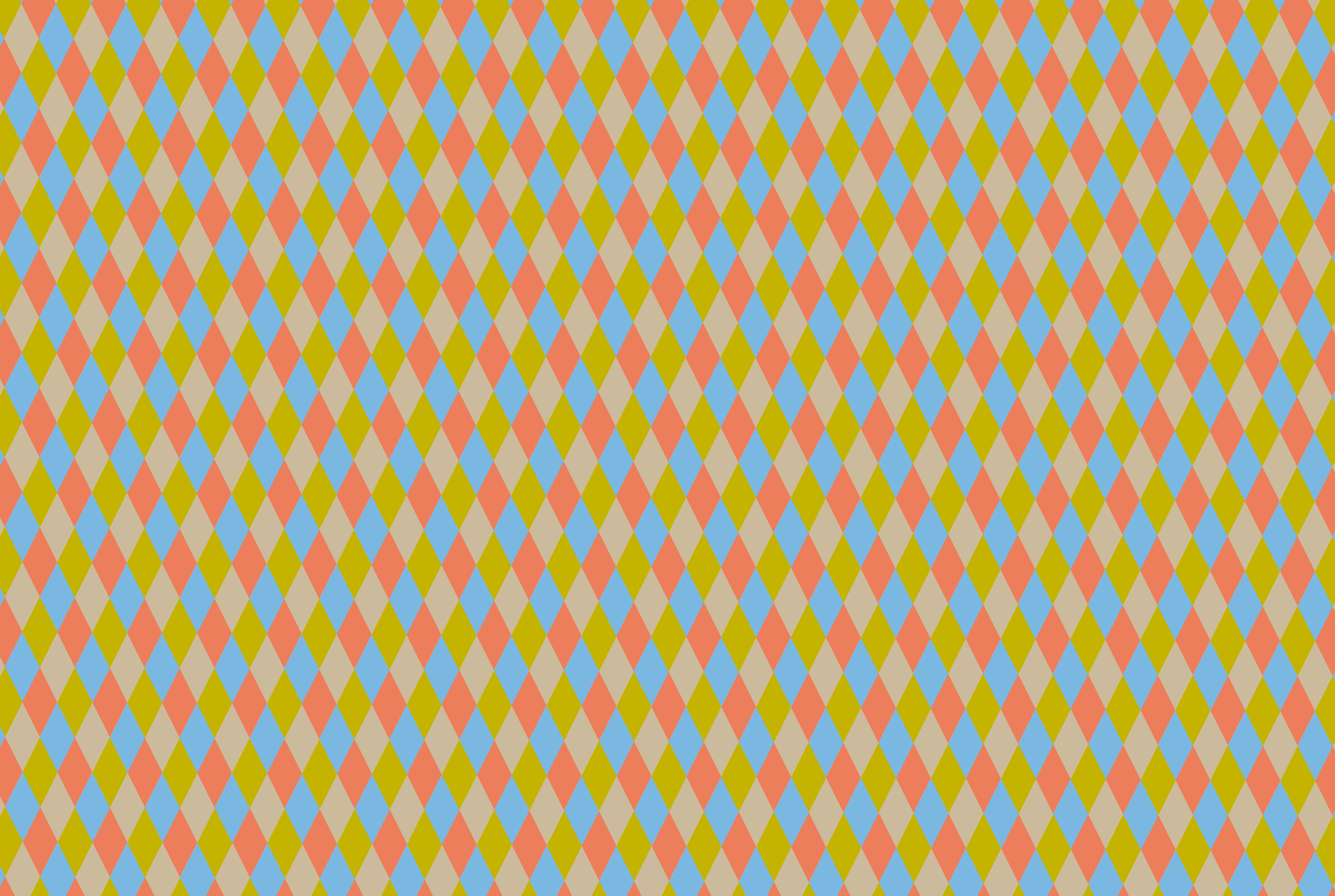Freiheit schien uns lange selbstverständlich. Heute ist der Begriff umkämpft. Doch was ist Freiheit überhaupt? Was macht sie so wertvoll?
Text: Thomas Vašek
Der chinesische Künstler Ai Weiwei ist alles andere als ein freier Mensch. Seit einem Jahr steht er unter Hausarrest. Er darf seine Wohnung nur kurz und unter strenger Aufsicht verlassen. Die Geheimpolizei baute vor seinem Haus berwachungskameras auf. Doch Ai Weiwei nahm sich die Freiheit. Im März installierte er selbst vier Kameras, die rund um die Uhr Bilder ins Internet übertrugen. Auf seiner Website sah man ihn beim Arbeiten, beim Essen, beim Schlafen. Ein paar Tage ging es so, bis die Behörden seine Seite sperrten. Mit seiner Selbstüberwachung protestierte er gegen die Berwachung durch das Regime. Ai Weiwei kann sich nicht frei bewegen. Doch seine Bilder gingen um die ganze Welt. Trotz seiner Unfreiheit, so scheint es, handelte er freier als viele andere. Aber was ist dann Freiheit? Bedeutet Freisein nur, von niemandem eingeschr nkt zu werden? Oder erfordert Freiheit mehr? Wird uns die Freiheit gegeben – oder müssen wir sie uns nehmen?
Wir haben Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, Freiheit der Meinungsäußerung, Versammlungs und Redefreiheit. In der Europäischen Union herrscht freier Waren-, Personen- und Kapitalverkehr. Auf dem freien Markt kann jeder kaufen und verkaufen, was er will. Wir können alle möglichen verrückten Dinge tun, auf die wir gerade Lust haben – und auch in der Liebe sind wir freier als je zuvor. Aber sind wir es wirklich?
Was Freiheit heißt, scheint jeder zu wissen. Frei zu sein: Lange hielten wir das für selbstverständlich wie den Strom, der aus der Steckdose kommt. Doch ist der Begriff umstritten. Die Freiheit des Bürgers setzen die einen gleich mit weniger Staat, für die anderen beruht wahre Freiheit auf Gerechtigkeit. Und auch unter dem Begriff liberal verstehen die Menschen ganz unterschiedliche Dinge. In einer Umfrage des Allensbacher Instituts für Demoskopie gab die Hälfte der Befragten möglichst wenig staatliche Vorschriften an, aber kaum weniger nannten den Abbau der Kluft zwischen Arm und Reich, weniger staatliche Eingriffe in die Wirtschaft und die Senkung von Steuern und Abgaben. Freiheit bedeutete zu verschiedenen Zeiten etwas anderes. Die Bürger der römischen Republik konnten an öffentlichen Beratungen teilnehmen, sie waren eingebunden in politische Entscheidungen. Doch als einfache Bürger standen sie zugleich unter der Knute des Kollektivs – und die nötige Muße, ihre Freiheit auszuüben, verdankten sieihren Sklaven. Der französische Staatstheoretiker Benjamin Constant (1767–1830) nannte das die Freiheit der Antike . In modernen Gesellschaften dagegen verliere das Individuum seinen Stellenwert – und so seinen Einfluss auf die Politik. Damit habe sich auch das Freiheitsverst ndnis ver ndert, meinte Constant. Der moderne Mensch strebe nach privater Unabhängigkeit, und unter Freiheit verstehe er die Garantie des Staates, diese Unabh ngigkeit sicherzustellen. Das verbreitete Desinteresse an der Politik zeigt, dass Constant nicht ganz unrecht hatte. Nach gängiger Auffassung heißt Freiheit heute, tun und lassen zu können, was man will. Aber diese Definition ist sehr ungenau. Ein Extremkletterer, der auf einen einzigen Griff angewiesen ist, kann sicher nicht tun, was er will. Trotzdem kämen wir nicht auf die Idee, ihn für unfrei zu halten. Unter Freiheit verstehen wir zumeist, dass wir keinen Zwängen unterliegen. Offenbar kommt es dabei auf unsere Beziehung zu anderen an. Auch wenn mir nur ein einziger Weg offensteht, weil die anderen blockiert sind, kann ich frei sein. Ganz anders ist es hingegen, wenn mich jemand dazu zwingt, einen bestimmten Weg zu nehmen. Nach einer plausiblen Definition heißt Freiheit, nicht dem Willen eines anderen unterworfen zu sein.
Ohne Freiheit sind wir Vorurteilen
und Dogmatismus ausgeliefert.
Nach John Stuart Mill (1806–1873) brauchen wir Freiheit, um unsere menschlichen Fähigkeiten, unsere Individualität zu entfalten. Ohne individuelle Freiheit kann sich unsere Zivilisation nicht weiterentwickeln. Freiheit ist also nützlich – und es ist unvernünftig, sie zu unterdrücken. Nehmen wir das Beispiel der Rede- und Meinungsfreiheit. Um die Erkenntnis voranzubringen, brauchen wir Mill zufolge Dissens. Schließlich können wir nie sicher sein, dass eine scheinbar falsche Meinung auch tatsächlich falsch ist. Und selbst eine falsche Meinung kann helfen, die Wahrheit herauszufinden. Ohne Freiheit sind wir Vorurteilen und Dogmatismus ausgeliefert. Selbst wenn alle Menschen außer einem einzigen derselben Meinung wären, so schreibt Mill in seinem Essay über die Freiheit , wäre die ganze Menschheit nicht dazu berechtigt, diesen einen mundtot zu machen. Zugleich sollten die Menschen aber auch die Freiheit haben, nach ihren Fähigkeiten und Anlagen zu leben. Individualität erfordert Freiheit: Das Genie kann nur frei atmen in einer Atmosphäre von Freiheit , schreibt Mill. Gegen die Einmischung der Öffentlichkeit spricht schon, dass sie mit gro er Wahrscheinlichkeit am falschen Platz erfolgt. Mills berühmtes Prinzip lautet: Der Staat darf sich in die Handlungsfreiheit des Individuums nur dann einmischen, wenn es darum geht, sich selbst zu schützen – oder Schaden für andere abzuwenden. Individuelle Freiheit ist für Mill dabei nicht notwendig verknüpft mit Demokratie; sie hängt nicht von der Staatsform ab, sondern von den unmittelbaren Einschränkungen, denen der Bürger unterliegt.
Negative Freiheit meint die Abwesenheit von Behinderungen.
Der britische Philosoph Isaiah Berlin (1909–1997) unterschied in seinem einflussreichen Essay Zwei Freiheitsbegriffe zwischen negativer und positiver Freiheit. Negative Freiheit meint die Abwesenheit von Behinderungen. Niemand schränkt mich ein, mir stehen alle Wege offen, ich kann tun und lassen, was ich will. Die klassische Definition stammt vom englischen Staatstheoretiker Thomas Hobbes (1588–1679): Freiheit begreift ihrer ursprünglichen Bedeutung nach die Abwesenheit aller äußeren Hindernisse in sich. Wenn das Hindernis hingegen ein innerliches ist, fehle es nicht an Freiheit, sondern an Vermögen. Nach Hobbes ist sogar ein Sklave frei, solange er sich nur frei bewegen kann. Und ein Armer mag zwar nicht dazu imstande sein, sich seine Wünsche zu erfüllen, doch unfrei ist er nicht. Genau das bestreiten die Anhänger eines positiven Freiheitsbegriffs. Positive Freiheit meint demnach Selbstbestimmung: Ich realisiere meine Fähigkeiten und Ziele, ich bin Herr meines eigenen Lebens. Nur in einer politisch freien Gesellschaft kann auch das Individuum selbstbestimmt leben, sagen die Vertreter des positiven Freiheitsbegriffs. Und wer arm oder unwissend ist, kann seine Möglichkeiten nicht verwirklichen. Zwar verbietet niemand einem Hartz-IV-Empfänger, sich einen Mercedes zu kaufen. Aber er kann sich eben keinen leisten – und insofern ist er nicht wirklich frei. Bei der negativen Freiheit geht es um Möglichkeiten. Die positive Freiheit dagegen ist etwas, das man erst verwirklichen muss.
Die positive Freiheit dagegen ist etwas, das man erst verwirklichen muss.
Auf den ersten Blick scheinen beide Begriffe auf das Gleiche hinauszulaufen. Doch Berlin hielt sie für rivalisierende Konzeptionen. Positive Freiheit heißt, sich selbst zu verwirklichen – also sein wahres Selbst zur Geltung zu bringen. Aber wer weiß schon, was das wahre Selbst ist? Die Vernunft? Irgendein höherer Plan? In dieser Vorstellung liegt für Berlin schon der erste Schritt auf dem Weg in die Tyrannei. Schließlich gibt es immer Leute, die zu wissen glauben, was gut für andere ist – und dass man sein wahres Selbst nur auf bestimmte Weise realisieren kann, in einer bestimmten Partei, einer bestimmten Religion oder Gesellschaftsform: Sobald ich mir diese Ansicht zu eigen gemacht habe, bin ich in der Lage, die tats chlichen Wünsche von Menschen und Gesellschaften zu ignorieren und Menschen und Gesellschaften im Namen und zum Wohle ihres wirklichen Selbst zu drangsalieren, zu unterdrücken, zu foltern. Wenn Freiheit nur bedeutet, das tun zu können, was man sich wünscht, dann kann man sie auch dadurch erlangen, indem man sich einfach weniger wünscht. Und dann ist auch derjenige frei, der nur das tun kann, was er sich wünscht. So gesehen ist auch der zufriedene Sklave frei, schließlich wünscht er sich ja nichts anderes. Wer seine Wünsche an die Realit t anpasst statt umgekehrt, der ist immer zufrieden. Das ist der Weg der Stoiker und Buddhisten, die wahre Befreiung im Rückzug von der Welt sehen. Wer Wundschmerz bek mpfen will, sagt Isaiah Berlin, der kann versuchen, die Wunde zu heilen – aber er kann sich eben auch sein Bein abhacken. Freiheit ist nicht dasselbe wie Glück. Jemand kann sich frei fühlen – und trotzdem nicht frei sein. Wenn ich nur eine einzige Option habe, die genau dem entspricht, was ich mir am sehnlichsten wünsche, dann bin ich vielleicht zufrieden – aber nicht frei. Zur Freiheit gehört offenbar auch, dass wir das tun können, was wir nicht wünschen.
Handle so, dass der freie Gebrauch deiner Freiheit mit der Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen könne.
Aber reicht es nicht, wenn wir als rationale Wesen das tun können, was wir für vernünftig halten? Heißt wahre Freiheit nicht, sich einem Prinzip zu unterwerfen, das alle akzeptieren können? Nach Kant unterliegt der Gebrauch der Freiheit dem kategorischen Imperativ – also stets nach derjenigen Maxime zu handeln, von der man wollen kann, das sie allgemeines Gesetz werde. Zur Freiheit gehört nach Kants Auffassung nicht die Freiheit, das Irrationale zu tun, schreibt Berlin: Wenn mir ein Gesetz verbietet, was ich als Vernunftwesen unm glich wollen kann, so ist das keine Einschränkung meiner Freiheit. Wahre Freiheit besteht nach Kant genau darin, dass das Individuum seine ungezügelte, gesetzlose Freiheit aufgibt, um sich dem moralischen Gesetz zu unterwerfen: Handle so, dass der freie Gebrauch deiner Freiheit mit der Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen könne. Freiheit darf also auch eingeschränkt werden – nämlich dann, wenn ein bestimmter Gebrauch der Freiheit die Freiheit anderer einschränkt. Doch auch dahinter steckt für Isaiah Berlin wieder die fatale Vorstellung eines wahren Selbst, das sich mit einem bestimmten Prinzip identifiziert und unser oft irrationales Handeln ins richtige Schema zwingt – und somit der positive Freiheitsbegriff. Dieser führt für Berlin letztlich in den autoritären Staat, der seinen Bürgern vorschreibt, wie sie ihr Leben führen sollen – also zum genauen Gegenteil dessen, was die Anhänger des negativen Freiheitsbegriffs zu erreichen suchen: Jene wollen die Staatsgewalt als solche eindämmen. Diese wollen die Staatsgewalt selbst in die Hand bekommen. Genau deshalb handele es sich um zwei grundverschiedene, unvereinbare Einstellungen zu den Zielen des Lebens. Frei zu sein ist nicht jedermanns oberstes Bedürfnis, schreibt Berlin. Und sicher gibt es Situationen, in denen andere Dinge wichtiger sind. Wer in extremer Armut lebt, braucht vielleicht zuerst etwas zu essen. Doch nach Berlin dürfen wir Freiheit nicht mit anderen Werten verwechseln: Jedes Ding ist das, was es ist: Freiheit ist Freiheit – und nicht Gleichheit oder Fairness oder Gerechtigkeit oder Kultur oder menschliches Glück oder gutes Gewissen. Niemand kann wissen, was die wahren, die guten Ziele sind. Menschen haben verschiedene Werte und Interessen. Genau deshalb brauchen wir nach Berlin einen Wertepluralismus, der es uns erm glicht, Ziele zu wählen, ohne ewige Gültigkeit für sie in Anspruch zu nehmen – und das Maß an negativer Freiheit, das er mit sich bringt.
Freiheit ist Freiheit – und nicht Gleichheit oder Fairness oder Gerechtigkeit oder Kultur oder menschliches Glück oder gutes Gewissen.
Aber müssen wir nicht auch den negativen Freiheitsbegriff überdenken? Bedeutet Freiheit nicht viel mehr als die Abwesenheit äußerer Hindernisse? Schließlich können ja auch innere Hindernisse die Verwirklichung unserer Möglichkeiten blockieren. Das Konzept der negativen Freiheit sei daher nicht haltbar, behauptet der kanadische Philosoph Charles Taylor. Auch bei u eren Hindernissen unterscheiden wir nach dem Ausmaß, indem sie unsere Freiheit bedrohen. So schränken etwa Verkehrsampeln unsere Freiheit ein, doch diese Einschränkung scheint uns kaum der Rede wert. Niemand käme auf die Idee, Nordkorea für freier zu halten als Deutschland, weil es dort weniger Ampeln gibt. Ganz anders hingegen ist es bei der Religionsfreiheit. Offenbar halten wir verschiedene Freiheiten für unterschiedlich bedeutsam. Dabei gehen wir nach Taylor von einem bestimmten Verständnis aus, was wir für wichtig halten und was nicht. Wir verfolgen also Ziele, und dazu müssen wir unsere Wünsche bewerten. Doch dabei kann es zu Konflikten kommen: Ein Wunsch kann uns daran hindern, ein Ziel zu erreichen, das wir eigentlich für wichtiger halten – etwa wenn jemand aus Bequemlichkeit etwas nicht tut, was er eigentlich unbedingt tun will. Und manchmal verzerren unsere Wünsche sogar die Sicht auf unsere eigenen Ziele. Freiheit bedeutet nach Taylor nicht bloß das Fehlen äußerer Hindernisse, also negative Freiheit – sondern die Fähigkeit, eigene Ziele zu verfolgen. Das aber erfordert, dass wir überhaupt in der Lage sind, diese Ziele richtig zu bestimmen. Doch wenn das so ist: Was kann oder soll der Staat dann überhaupt zur Selbstverwirklichung seiner Bürger beitragen?
Der klassische Liberalismus betont Freiheit, Toleranz, individuelle Rechte und Demokratie. Dazu gehören auch grundsätzliches Misstrauen gegen den Staat und das Vertrauen in den freien Markt. Die Gemeinschaft, die Kultur ist kein Zweck an sich. Die Menschen verfolgen selbst Ziele, dafür brauchen sie nur einen regelnden Rahmen. Innerhalb des Liberalismus gibt es allerdings eine Vielzahl unterschiedlicher Standpunkte. So herrscht Uneinigkeit über die Frage des Eigentums, über wirtschaftliche Gleichheit und die Rolle des Staates. Schon im 19. Jahrhundert wandten sich einige Liberale gegen einen Laissez-faire-Kapitalismus und traten für staatliche Interventionen ein. Freiheit schien ihnen nur realisierbar unter günstigen sozialen Bedingungen: Nicht nur staatlicher Zwang bedroht die Freiheit, sondern auch extreme gesellschaftliche Ungleichheit. Auch eine Reihe moderner Philosophen versucht, Freiheit und Gerechtigkeit miteinander zu verbinden. Die alte Dichotomie zwischen positiver und negativer Freiheit halten dabei viele für überflüssig, ja für ein Relikt aus der Zeit des Kalten Krieges. Viele gehen lieber von einer einheitlichen Freiheitsdefinition aus: Ein freier Mensch ist demnach frei von dieser oder jener Einschränkung und kann dieses oder jenes tun (oder lassen).
Nicht nur staatlicher Zwang bedroht die Freiheit, sondern auch extreme gesellschaftliche Ungleichheit.
Nach Auffassung des amerikanischen Philosophen John Rawls (1921–2002) hat jede Person den gleichen unabdingbaren Anspruch auf ein angemessenes System gleicher Grundfreiheiten, das mit demselben System von Freiheiten für alle vereinbar ist. Sein Argument beruht auf einem Gedankenexperiment: In einem hypothetischen Urzustand sollen sich Parteien auf bestimmte Grundsätze einigen, um das Beste für die von ihnen vertretenen Personen zu tun. Allerdings handeln sie unter einem Schleier der Unwissenheit, sie kennen also die soziale Position der von ihnen vertretenen Personen, ihre Lebensziele und Neigungen nicht. Und sie wissen auch nicht, ob die Anschauungen ihrer Mitglieder von einer Mehrheit oder einer Minderheit geteilt werden. Aus diesem Grund können sie vernünftigerweiser keine Grundsätze beschließen, die einer Gruppe weniger Freiheit einräumen als einer anderen. Schließlich könnten die von ihnen vertretenen Personen ja selbst zu dieser Minderheit gehören. Als rationale Akteure müssen sie nach Rawls also Grundsätze wählen, die allen gleiche Grundfreiheiten garantieren. Doch auch wenn alle die gleichen Freiheiten haben: Der Wert der Freiheit ist nicht für jedermann derselbe, so Rawls. Daher muss nach seiner Theorie ein Ausgleich geschaffen werden. Die Grundfreiheiten sollen allen Bürgern die sozialen Bedingungen garantieren, um ihre Lebensziele verfolgen zu können. Nach seiner Theorie ist das System so zu gestalten, dass der Wert der Freiheit für die am wenigsten Begünstigten möglichst groß wird. Das ist das Ziel der sozialen Gerechtigkeit.
Gibt es überhaupt ein Recht auf Freiheit?
Gibt es überhaupt ein Recht auf Freiheit? Der amerikanische Rechtsphilosoph Ronald Dworkin bestreitet das. Den Begriff Recht definiert er dabei in einem starken Sinne: Jemand hat ein Recht auf etwas, wenn es ihm der Staat auch dann nicht verwehren kann, wenn das im allgemeinen Interesse w re. Nach Dworkin habe ich etwa kein Recht, eine Straße in einer bestimmten Richtung entlangzufahren. Die Verkehrsbehörde könnte die Straße nämlich einfach zur Einbahnstraße erklären. Ein solcher Freiheitsverlust kommt uns in der Regel natürlich belanglos vor. Anders sehen wir es etwa bei der Meinungsfreiheit. Die halten wir für ein hohes Gut, das der Staat unbedingt schützen muss. Aber welchen Ma stab sollen wir anlegen, um verschiedene Freiheiten miteinander zu vergleichen? Schließlich fällt es schwer, die Freiheit einfach als ein Gut zu betrachten, das in verschiedenen Quantitäten vorhanden sein kann. Freiheit kann man offenbar nicht einfach über einen Leisten schlagen. Zudem betreffen manche Einschränkungen nicht die Freiheit als solche, sondern andere Werte oder Interessen, im Falle der Einbahnstraße etwa die Bequemlichkeit des Fahrers. Die Idee eines Rechts auf Freiheit sei für das politische Denken sogar schädlich, meint Dworkin, sie erzeuge eine falsche Vorstellung vom Konflikt zwischen Freiheit und anderen Werten. Aber warum gestehen Staaten ihren Bürgern dann bestimmte Freiheitsrechte zu? Eine naheliegende Erklärung
wäre, dass die Verweigerung dieser Rechte die Bürger in irgendeiner Weise schädigt. Diese Argumentation lässt sich allerdings nur schwer durchhalten. Schließlich üben die meisten Bürger ihre politischen Freiheitsrechte gar nicht aus. Folglich würde es ihnen wom glich gar nicht schaden, wenn sie diese Rechte nicht hätten. Das zentrale Konzept für Dworkin heißt daher nicht Freiheit, sondern Gleichheit. Jeder hat das Recht auf gleiche Rücksichtnahme und Respekt. Dworkin verteidigt dabei eine liberale Konzeption von Gleichheit: Der Staat darf die Freiheit nicht aus dem Grund beschränken, dass er den Lebensentwurf eines Bürgers für wertvoller hält als den
eines anderen.
Jeder hat das Recht auf gleiche Rücksichtnahme und Respekt.
Freiheit verwirklichen wir nicht im luftleeren Raum. In unserem Handeln sind wir immer bezogen auf andere – auf eine soziale Realität. Nach Hegel beruht Freiheit auf wechselseitiger Anerkennung: Es reicht nicht, mein Handeln an selbstbestimmten Zielen zu orientieren. Als isoliertes Subjekt bleibe ich von der sozialen Realität abgeschnitten: Ich weiß gar nicht, ob ich meine Ziele überhaupt realisieren kann. Meine Selbstverwirklichung hängt ab von der Selbstverwirklichung des anderen. Als Beispiel nennt Hegel Liebe und Freundschaft: Hier ist man nicht einseitig in sich, sondern man beschränkt sich gern in Beziehung auf ein anderes, weiß sich aber in dieser Beschränkung als sich selbst, schreibt Hegel in seinen Grundlinien der Philosophie des Rechts. Um diese wechselseitige Anerkennung zu gewährleisten, braucht es aber Verhaltenspraktiken und Institutionen. An diese Idee Hegels knüpft der deutsche Philosoph Axel Honneth in seinem Buch Das Recht der Freiheit an. Soziale Freiheit realisiert sich demnach in verschiedenen sozialen Handlungssphären – in Freundschaft und Familien, im marktwirtschaftlichen Handeln, in der demokratischen Öffentlichkeit. Auch der amerikanische Philosoph Philip Pettit von der Princeton University definiert Freiheit als eine Form von Anerkennung: Frei zu sein heißt, dass ich für das verantwortlich gemacht werden kann, was ich tue. Pettits Konzept knüpft an unsere allt glichen Erfahrungen an. Indem wir loben oder tadeln, indem wir uns dankbar zeigen, schreiben wir anderen verantwortliches Handeln zu. Wenn ich für mein Handeln verantwortlich gemacht werden kann, bin ich offenbar eine besondere Art Person. Man kann mich nämlich in eine Praxis einbeziehen, in der Menschen einander Verantwortung für ihr Handeln zuschreiben. Das erklärt zum Beispiel, warum Tiere nicht frei sind: Sie können für ihre Handlungen nicht verantwortlich gemacht werden. Aber was macht die Eignung einer Person aus, für ihr Tun verantwortlich gemacht zu werden? Nach Pettit erfordert Freiheit mehr als die Fähigkeit zu rationaler Selbststeuerung. Eine freie Person muss au erdem die Fähigkeit besitzen, in einen Diskurs einzutreten – also etwa mit anderen vernünftig über ein Problem zu diskutieren. Eine Person ist demnach so lange frei, als sie diskursive Kontrolle über ihre Handlungen hat. Nicht jeder Zwang unterminiert diesen diskursiven Status. Odysseus ließ sich bekanntlich von seinen Kameraden an den Mast fesseln, um dem betörenden Gesang der Sirenen zu widerstehen. Nach der Theorie der negativen Freiheit hat er damit seine Freiheit eingebüßt, schlie lich kann er sich ja nicht mehr bewegen. Nach Pettits Theorie hingegen hat er seinen diskursiven Status gewahrt – und damit auch seine Freiheit.
Freiheit verwirklichen wir nicht im luftleeren Raum. In unserem Handeln sind wir immer bezogen auf andere – auf eine soziale Realität.
Aus liberaler Sicht soll der Staat seine Bürger möglichst weitgehend in Ruhe lassen. Aber diese Auffassung unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Formen der Einmischung, etwa zwischen solchen, die im Interesse der Person liegen, und solchen, die dem zuwiderlaufen. Und offenbar kann unsere Freiheit auch bedroht sein, ohne dass eine tatsächliche Einmischung in unsere Angelegenheiten stattfindet. Wer von der Gnade eines anderen abhängig ist, der ist nach Pettit unfrei – auch wenn der andere seine Macht gar nicht ausübt. Es genügt, dass er sie ausüben könnte. Genau aus diesem Grund ist auch ein zufriedener Sklave unfrei. Philip Pettit stellt in seiner Theorie
der Freiheit deshalb die Idee der Nichtbeherrschung in den Vordergrund – eine Art Mittelweg zwischen positiver und negativer Freiheit. Im Unterschied zum Konzept der positiven Freiheit erfordert Nichtbeherrschung nicht die volle Autonomie des Individuums. Zugleich richtet sich das Konzept nicht gegen Einmischung als solche, sondern nur gegen willkürliche Einmischung. Allerdings kommt es nicht darauf an, ob die Einmischung tats chlich stattfindet. Schon die bloße Macht dazu, ob sie ausgeübt wird oder nicht, schr nkt die Freiheit ein. Pettit gehört zu den Vertretern des Republikanismus, einer Freiheitstheorie, die an das republikanische Denken des antiken Roms und später der Renaissance anknüpft. Nach dieser muss eine freie Gemeinschaft vom Willen ihrer Bürger getragen sein. Dazu muss der Staat den Bürgern Möglichkeiten zur Partizipation geben.
Freiheit ist nicht bloß etwas, das man geschenkt bekommt.
Nach Pettit geht es jedoch nicht darum, Konsens herzustellen. Um willkürliche Machtausübung zu verhindern, braucht es vielmehr Möglichkeiten, die staatliche Macht anzufechten. Die Bürger müssen die Möglichkeit haben, gegen Handlungen des Staates zu protestieren, wenn sie ihren Interessen zuwiderlaufen. Die Freiheit des Bürgers gibt es also nicht ohne Partizipation. Das ist sicherlich ein Argument für mehr direkte Demokratie. Doch man kann das republikanische Prinzip der Nichtbeherrschung auch in einem umfassenderen Sinne verstehen. Nach Pettits Theorie schaffen Abhängigkeitsverhältnisse Unfreiheit. Das gilt aber nicht nur für das Verhältnis zwischen Staat und Individuum. Beherrschung tritt in vielen Formen auf. Man denke an Kinder, die der Willkür gewalttätiger Eltern ausgeliefert sind. Oder an die alleinerziehende Hartz-IV-Empfängerin, die abhängig ist vom Sozialstaat. Das ist der Mitarbeiter, der um seinen Arbeitsplatz fürchtet – und deshalb alle Launen des Chefs erträgt. Der Anwohner in gefährlichen Gegenden, der sich kaum aus der Wohnung traut. Der Arbeitskraft Unternehmer in prek ren Verhältnissen, der umseinen nächsten Auftrag bangt. Andererseits ist nicht überall, wo der Staat ins Leben seiner Bürger eingreift, auch gleich die Freiheit gefährdet. Freiheit: Das heißt heute sicherlich nicht nur weniger Staat. Freiheit ist nicht bloß etwas, das man geschenkt bekommt. Man muss sie sich auch nehmen – oder darum kämpfen. Tag für Tag, in allen Bereichen des Lebens. Die republikanische Idee der demokratischen Teilhabe, wie sie neuerdings auch die Piratenpartei vertritt, ist vielleicht allzu optimistisch. Aber sie weist in die richtige Richtung, weil sie nicht nur vom Staat fordert, unsere Freiheit zu gewährleisten, sondern auch uns Bürgern etwas abverlangt. Vielleicht sind wir also gar nicht so frei, wie wir glauben. Denn zur Freiheit gehört auch, dass man sie nützt – und wenn nur ein kleines Quäntchen davon übrig ist. In diesem Sinne ist Ai Weiwei freier, als wir denken.