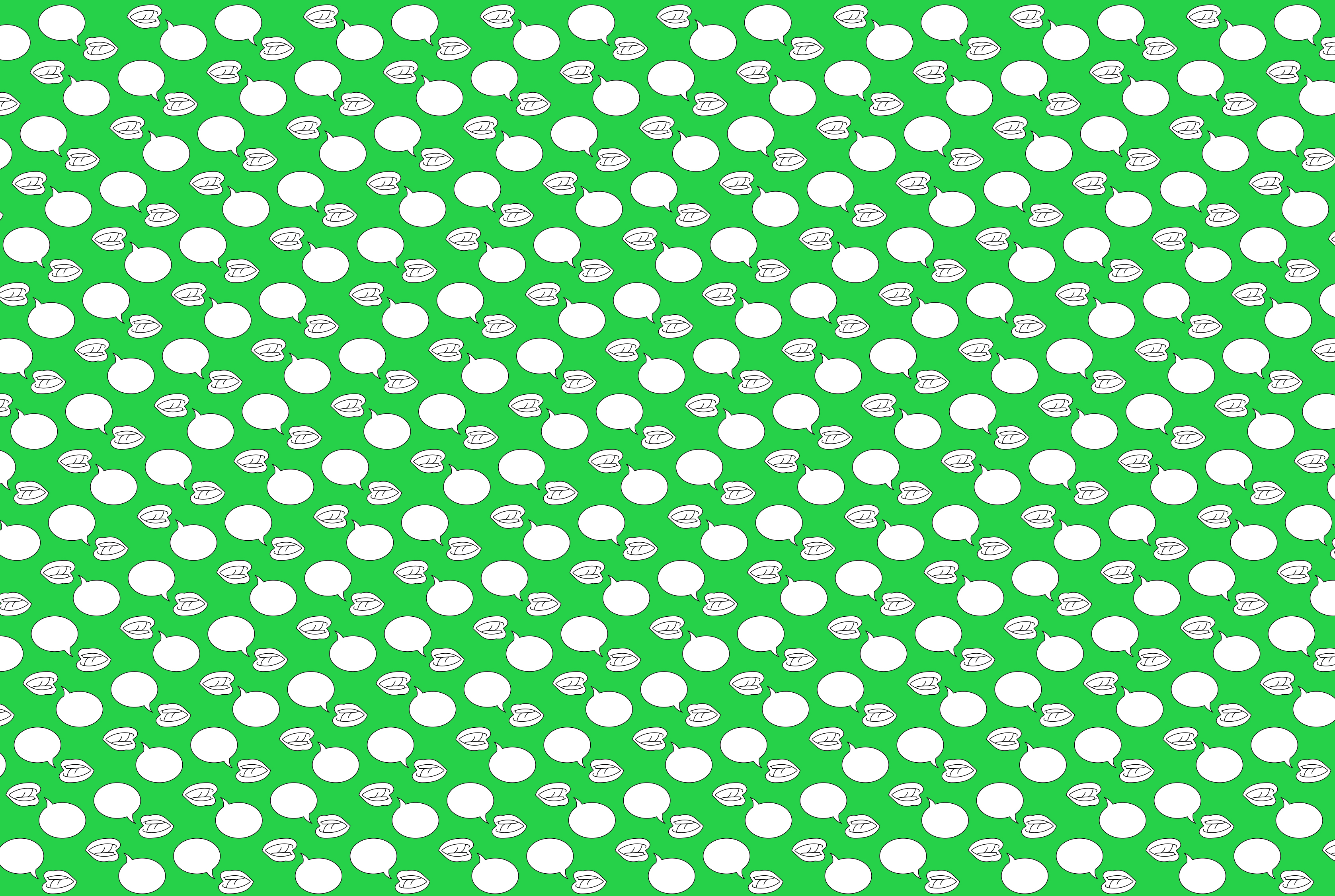Von Manuel Güntert
Aktuell gewichtigen Einfluss auf den Diskurs nimmt eine Figur, von der eigentlich angenommen werden muss, sie sei angetreten – worden! –, ihn zu unterbinden. Es handelt sich um das Sprechverbot. Die Frage dabei ist, ob es wirklich Sprechverbote gibt, die die Meinungsfreiheit empfindlich einschränken, oder ob einem dergestalt argumentierenden Sprecher der Verweis auf ein solches nicht eher dazu dient, seine eigene Sprechposition über einen nur vermeintlichen Tabubruch zu akzentuieren, um sich selbst in diesem Zug zu erhöhen. Es wäre dies eine Selbstheroisierung, die so weit gehen kann, dass die Kausalitäten sich kehren, und der Verweis auf ein Sprechverbot, das angeblich überschritten wird, dieses erst schafft. Die Kippfigur dazu wäre entsprechend die Selbstviktimisierung, in der ein Sprecher sich als Opfer eines Meinungsdiktates ausweist, obschon kein wirklich nachvollziehbarer Grund dafür vorliegt.
Treten wir einmal einen Schritt hinter diese Debatte zurück, um die nur vermeintlich lapidare Frage zu stellen, was ein Sprechverbot eigentlich ist. Seinem Namen nach will es erreichen, dass etwas Bestimmtes nicht mehr gesagt werden kann. Es ließe sich noch zwischen einem expliziten Sprechverbot unterscheiden, das in bestimmten Äußerungen einen zu ahndenden Tatbestand verortet und einem impliziten, das eher Sanktionen in Form sozialer Ächtung nach sich zieht. Dabei ergibt auch ein implizites Sprechverbot nicht viel Sinn, wenn es nicht Gültigkeit für alle Mitglieder jenes sozialen Verbundes beansprucht, für das es gelten soll. Möglichst keiner der Teilhaber soll das, was nicht mehr gesagt werden soll, noch sagen dürfen. Deshalb zeigt, wer imstande ist, erfolgreich ein Sprechverbot zu verhängen und durchzusetzen, dass er entweder aus einer Machtposition heraus agiert oder sich durch diesen Akt in eine Machtposition geschoben hat. Schließlich wird derart ein für alle gültiger Maßstab etabliert.
Nun können wir noch einen weiteren Schritt zurücktreten, um die zunächst etwas naiv anmutende Frage aufzuwerfen, woher das Sprechverbot sich selbst überhaupt kennt. Ihm liegt der Gedanke zugrunde, dass das, was verboten werden soll, irgendeiner bestimmbaren sozialen Entität einen ihr nicht zumutbaren Schaden zufügt. Für ein Sprechverbot gilt somit, was Foucault für ein Gesetz festgestellt hat: Es arbeitet zunächst im Imaginären, da ein Verbot nun einmal nur imaginiert und sich nur ausdrücken kann, indem es sich all die Dinge vorstellt, die getan werden könnten und nicht getan werden dürfen.[1]
Um überhaupt als schädigend festgestellt werden zu können, muss das Sprechverbot denkend schon überschritten worden sein.
Ein Sprechverbot bewegt sich in eigentümlich anmutenden Abhängigkeiten: Wird es erfolgreich erhoben, wird das, was verboten wird, überhaupt erst »offiziell« zu dem Schädigenden, als das es vorgängig erkannt worden ist. Dabei wird dasselbe Verbot, das bestimmte Äußerungen als schädigend kennzeichnet, erst durch das ermöglicht, was es verbietet. Als das Verbot, das es nunmehr ist, kann es nur existieren, wenn es genau das unterbindet, was ihm die Existenz sichert; als Gedankengut muss das zu Verbietende schließlich schon vor seinem Verbot verfügbar sein und es muss nach dem Verbot als solches weiterhin verfügbar bleiben.
Um überhaupt als schädigend festgestellt werden zu können, muss das Sprechverbot denkend schon überschritten worden sein. Seine denkende Überschreitung ist darüber hinaus eine unerlässliche Bedingung, es überhaupt aufstellen zu können. Denn wäre die schädigende Wirkung dessen, was da verboten werden soll, nicht schon denkend antizipiert worden, entbehrte das Verbot schlechterdings einer Grundlage. So muss nicht nur, wer es erlässt, das Sprechverbot zwingend denken, sondern es muss nicht minder zwingend angenommen werden, ein veritabler Anteil jener, für die es Geltung annehmen soll, würde dieses Schädigende denken, das es zu verbieten gilt und weiterer Teil von ihnen würde überdies den Wunsch hegen, das, was da gedacht wird, auch auszusprechen. Denn würde eine gewisse Anzahl der Adressaten eines Sprechverbots den Wunsch des Verstoßes dagegen nicht hegen – würde man ihnen diesen Wunsch nicht zumindest unterstellen –, das zu sagen, was es verbietet, wäre dieses schlechterdings obsolet.
Somit bleibt das, was verboten wird, zwingend als Denkinhalt erhalten, und dadurch auch potentiell umsetz-, also sagbar. Da Denken Reden mit sich selbst ist, folglich sich auch innerlich hören meint,[2] stellt sich das Sprechverbot zwischen die innere, lautlose Stimme des Denkens und die äußere, hörbare Stimme. Es bindet etwas, das von einer gewissen Anzahl Menschen gesagt werden will, in deren Denken zurück. Da die stumme innere Stimme des Denkens sagen muss, was die hörbare »äußere« Stimme nicht mehr sagen darf, kann ein Sprechverbot das, was es verbietet, gerade nicht tilgen. Im Gegenteil ist es aus Selbsterhaltungsgründen zwingend auf die Fortexistenz dessen angewiesen, das es verbietet.
Das Sprechverbot erfordert deshalb eine stete Kontrolle, die dafür sorgt, dass nicht mehr gesagt wird, was eben verboten worden ist. Es stellt sich deshalb nicht nur zwischen Denken und Sprechen, sondern es steht in noch einem Dazwischen: Ein Sprechverbot vollzieht sich schlicht, wenn man sich daran hält, aber es wird überflüssig, wenn jeder sich jederzeit daran hält. Um seine Notwendigkeit und Nützlichkeit immer wieder neu zu untermauern, braucht es den permanenten Verstoß gegen sich selbst. Das Sprechverbot steht deshalb zwischen seiner breitflächigen Akzeptanz, auf die es zu seinem Funktionieren angewiesen ist und einer dieser entgegenstehenden partiellen Nicht-Akzeptanz – das wäre seine Überschreitung –, die es zum Funktionieren genauso braucht.
Den Beherrschten bleibt fast nur noch die Anerkennung der vom herrschenden Sprachgebrauch gesetzten Kriterien.
Wer sich imstande zeigt, diese Kontrolle eines Sprechverbots aufrechtzuerhalten, der, darauf ist schon hingewiesen worden, weist sich dadurch als jemand aus, der aus einer Machtposition heraus agiert. Denn er trifft eine allgemeingültige Entscheidung über den nunmehr legitimen Sprachgebrauch. Bourdieu zufolge sind es gerade solche impliziten Aneignungsakte, über die die herrschende Klasse das wird, als was sie sich präsentiert: Indem sie sich die Macht über die legitime Sprache sichert, nämlich als Macht, die legitime Sprache zu definieren, und als Macht, sich die dergestalt definierte Sprache anzueignen, das heißt als Monopol nicht auf die Sprache (was in sich widersprüchlich wäre, da die Erfordernisse der Produktion und selbst der Herrschaft ein Minimum an Kommunikation zwischen den Klassen, also den Zugang auch der am stärksten Benachteiligten zu so etwas wie einem sprachlichen Existenzminimum, zwingend voraussetzen), sondern auf den legitimen Gebrauch der Sprache, der damit zum Kennzeichen von Zugehörigkeit und Ausschluss wird; und indem sie alle Formen des „gewöhnlichen“ Sprachgebrauchs, insbesondere diejenigen, die ausschließlich durch ihre praktischen Funktionen bestimmt sind, den anderen Klassen überlässt, gewährt sich die herrschende Klasse sämtliche mit diesen distinktiven, ja exklusiven Eigenschaften verbundenen materiellen und symbolischen Profite, zu deren Vorzügen nicht zuletzt die Tatsache gehört, dass sie darüber hinaus geradeso vollkommen legitim erscheinen wie die Eigenschaften, denen sie sich verdanken.[3]
Wer ein Sprechverbot erlässt, der greift insofern kontrollierend auf den gemeinsamen Gebrauch der Sprache zu, als er ein simples, potentiell für alle gültiges Inklusions- und Exklusionskriterium schafft: Wer das Verbot beachtet, ist inkludiert, wer es missachtet, wird exkludiert oder kann zumindest exkludiert werden. Wer in dieser Form über den ihm vorgegebenen Sprachgebrauch beherrscht wird, kann eigentlich, sofern er nicht von der Teilhabe ausgeschlossen werden will, gar nicht anders, als das Sprechverbot zu befolgen. Den Beherrschten bleibt fast nur noch die Anerkennung der vom herrschenden Sprachgebrauch gesetzten Kriterien.[4]
Im Sprechverbot offenbart sich aus demselben Grund aber auch schon eine „Lücke“, eine Lücke, die zugleich begründet, weshalb es erst erlassen wird. Dass per Verbot „nur“ über den Gebrauch der Sprache und nicht etwa die Sprache selbst verfügt werden kann, deutet auch daraufhin, dass das »Objekt der Begierde« – eben die Sprache – durch ein solches Verbot zwar eine gewisse Schließung erfährt – da ist ja jetzt etwas, das nicht mehr gesagt werden darf –, tatsächlich aber gerade deshalb offen geblieben ist. Die Sprache kann einem verändernden Zugriff – ein solcher ist ein Sprechverbot – auf sie wohl angepasst werden, nur demonstriert schon die die Möglichkeit eines solches Zugriffes, dass sie sich ihm auch schon wieder entzogen hat.
Mit anderen Worten: Was qua Sprechverbot einer andauernden Kontrolle unterzogen werden muss, zeigt just durch den Bedarf einer solchen Kontrolle, dass es gerade nicht unter Kontrolle steht. Deshalb existiert im dergestalt konstituierten Sprachgebrauch noch immer eine Lücke, in die man hineinstoßen kann, um auf die Sprache zuzugreifen und den Sprachgebrauch erneut zu verändern. Denn das Denken, das dem (Nicht!-)Sagen immer zu einem gewissen Maße entgegensteht, ist nicht absorbierbar. Lautlos im eigenen Kopf sagt es ja ständig, was es »außen« nicht mehr sagen darf.
Wie über die Sprache verfügt wird, von welcher Art Sprechverbote sind – je nachdem, von wo aus sie erlassen werden, können sie sich diametral entgegenstehen –, das entscheidet immer wieder neu über Teilhabe und Exklusion, die Sprache selbst bleibt aber, bei allen – auch den erfolgreichen – Versuchen, über sie zu verfügen, eigentümlich unverfügbar. Denn ein Sprechverbot, das auf einen gemeinsamen Sprachgrund zugreifen muss, um einen gewissen, für alle verbindlichen Sprachgebrauch festzulegen, ist zwingend auf das angewiesen, das es aus sich exkludieren will, aber gerade deshalb nicht aus sich exkludieren kann.
Ein Sprechverbot ist von nichts bedrohter als von sich selbst.
Da die Legitimationsbasis eines Sprechverbots ex negativo gelegt wird – über das, was nicht mehr gesagt werden darf, aber gerade deshalb zwingend gedacht werden muss –, fallen im Sprechverbot sein eigener Existenzgrund und das, was es auch schon wieder aufzulösen droht, in eins. Das, was das Sprachverbot eigentlich sichert – der potentielle Verstoß –, ist zugleich das, was es latent bedroht. Denn alle jene, die genau das sagen wollen, was verboten worden ist – ihr Sagenwollen stellt ja erst der Anlass bereit, es zu verbieten –, können potentiell nach wie vor verändernd auf den gemeinsamen Sprachgrund zugreifen. Das können sie ganz einfach, indem sie das sagen, was verboten worden ist – sie müssen sich allenfalls bereits zeigen, die anfallenden Sanktionen in Kauf zu nehmen.
Ein Sprechverbot ist demnach von nichts bedrohter als von sich selbst. Da es gar nicht anders kann, als unablässig auf das hinzuweisen, was es verbietet, hält es das auch permanent am Leben.[5] Solange nur ein einziger Gedanke existiert, der das denkt, was nicht gesagt werden soll, ist der aktuell herrschende Sprachgebrauch ein schwelend unsicherer, weshalb er Kontrollmittel – eben Sprechverbote – aufbieten muss, um sich in der herrschenden Form abzusichern. Auch das offenbart sich noch im Sprechverbot selbst: Wenn jemand auf einen gemeinsamen Grund zugreifen kann, um – über ein Verbot – einen »richtigen Sprachgebrauch« festzulegen, dann kann jemand anders das auch tun.
Insofern schirmt das Verbot einen gemeinsamen Sprachgrund ab, der sich aus demselben Grund einer umfassenden Kontrolle entzieht bzw. schon entzogen hat. Das bedeutet, die Sprache ist nie wirklich bei sich, sie ist nie »ganz«, sie ist nie abgeschlossen, sondern es gibt »nur« immer neue Bemühungen, sie abzudichten oder gar abzuschließen. Diejenige Macht, die aktuell über sie verfügt, kann über die Sprache wohl diejenigen von der Teilhabe entfernen, die sie »falsch gebrauchen«, aber die Sprache selbst bleibt insoweit anarchisch, als es nie gelingen wird, sie gänzlich zu kontrollieren.
Der vollständigen Kontrolle über ein Sprachverbot entgegen stehen einmal die Exkludierten, jene Marginalisierten, die vom herrschenden Sprachgebrauch von der Teilhabe ausgeschlossen werden. Solange sie sich dem Sprachgebrauch »fügen«, arbeiten sie aktiv – und gegen ihren Willen – an ihrer eigenen diesbezüglichen Kontrolle mit, im immer möglichen, weil nur zurückgebundenen, Verstoß sind aber zugleich der Ort, von dem aus dieselbe Kontrolle negiert werden kann. Für jene, die sich zu Unrecht kontrolliert sehen, ist es demnach zwar wichtig, leere Zwischenräume der Nicht-Kommunikation zu schaffen, störende Unterbrechungen, um der Kontrolle zu entgehen,[6] noch wichtiger aber wird es sein, überzeugend in die überall vorhandenen Lücken zu stoßen. Man soll es ja nicht für möglich halten, aber genau in diese immer offene Lücke sind auch schon jene gestoßen, die das Sprechverbot überhaupt erlassen haben.
Da noch, wer es fordert, das Sprechverbot als Inhalt verfügbar haben muss, steht einer vollständigen Kontrolle des Sprachgebrauches weiter das aus ihm Exkludierte entgegen, das sich in diesem Fall auf das im Einzelnen Denken Exkludierte bezieht – das also, was das Sprechverbot auf dem Weg vom Verstand in den Mund unterbinden muss. Denn zumindest die Gedanken jener, die Sprechverbote erlassen oder fordern, bleiben insoweit fürderhin »schuldig«, als sie das nicht-mehr-zu-Sagende zwingend denken müssen. Zu einem gewissen Maß muss ja, wer nach einem Sprechverbot verlangt, sich vor dem fürchten, das nach wie vor gesagt werden kann. Selbst einem Befürworter eines bestimmten Verbotes kann das »entwischen«, was nicht mehr gesagt werden soll. Das derart schuldige Denken ist deshalb als besagte immer aufklaffende Lücke zu verstehen, denn dieser unter Kontrolle zu bringende »Ort« ist auch schon jener, der sich seiner Kontrolle entzieht.
Deshalb kann ein Sprechverbot zwar für manche Menschen schwer erträglich sein, aber durch das, was es tut und das, was es nicht mehr tun kann, beinhaltet es immer auch schon eine Ermöglichung oder Chance. Deshalb ist die Frage, ob es denn Sprechverbote gäbe, tatsächlich eine »falsche Frage«. Natürlich gibt es sie und es muss sie genauso geben, wie es die Überschreitungen geben muss, auf denen sie beruhen und ohne die sie nicht existieren können. Ein Sprechverbot hilft mit, einen gewissen Sprachgebrauch zu etablieren, es ließe sich sogar sagen, dass ein verbindlicher Sprachgebrauch sich ohne Sprechverbote schlicht nicht durchsetzen lässt. Was gesagt werden kann, basiert immer auch auf dem, was das Sagen unterbunden hat: Ein bestimmter Satz kann deshalb immer von dem erfüllt sein, was er nicht sagt.[7]
In gewisser Weise ist das Sprechverbot sogar die Bedingung des Sprechens selbst. Das simpelste implizite Sprechverbot liegt in der Anwesenheit einer anderen Person. Denn man sagt ihr ja durchaus nie genau das, was man wirklich über sie denkt und umgekehrt ist das, was da gedacht und nicht gesagt wird, in seiner jederzeit möglichen, also sprechend zu vollziehenden Überschreitung auch schon das, das dafür sorgt, dass die vom Gegenüber diesbezüglich blockierte Sprache nicht stillsteht. Insofern ist ein Sprechverbot immer auch etwas, das in seiner immer möglichen Überschreitung die Sprache weitertreibt. Indes kann es zwar überaus mutig sein, endlich auszusprechen, dass der Kaiser nackt ist, aber – vielleicht ist der Kaiser ja überhaupt erst deshalb Kaiser geworden, weil er über den Mut verfügt hat, nackt spazieren zu gehen? So könnte, wer wirklich mutig sein will, statt auf das hinzuweisen, was ohnehin jeder sieht, einmal den Versuch wagen, selbst nackt spazieren zu gehen…
Manuel Güntert hat Soziologie, Philosophie und Politikwissenschaften an der Universität Konstanz studiert und dort auch promoviert. Er veröffentlicht demnächst ein Buch über den ontologischen Gottesbeweis und schreibt einen Blog.
[1] M. Foucault, Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Geschichte der Gouvernementalität I. Frankfurt am Main 2004: S. 76.
[2] I. Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Hamburg 1980: S. 101. In Platons „Sophistes“ sind für den Fremden Denken und Rede dasselbe, nur dass das innere Gespräch der Seele mit sich selbst, was ohne Stimme vor sich geht, Denken genannt worden ist. Hier wird von einer lautlosen Stimme ausgegangen. Platon, Sophistes. In: Sämtliche Werke Band 3. Reinbek bei Hamburg 1994: 263e.
[3] P. Bourdieu, Sprache. Schriften zur Kultursoziologie 1. Berlin 2017: S. 69.
[4] Für Bourdieu können die Beherrschten die Kollaboration nicht verweigern – Anmerkung Verfasser: es wäre hier empfohlen, das Wort „kaum“ zu gebrauchen –: So also sind die beherrschten Klassen – und insbesondere die Kleinbürger – zu jener kenntnisfreien Anerkenntnis verurteilt, die durch das ängstliche Bemühen um „Korrektheit“, zu dem es sie treibt, der Ursprung der für ihre sprachlichen Produktionen bei allein offiziellen Anlässen so charakteristischen Überkorrektheit ist. Er spricht von einer symbolischen Enteignung, wenn die Enteigneten an ihrer Enteignung mitarbeiten und bei der Bewertung der eigenen Produktion wie der anderen diejenigen Kriterien übernehmen und anwenden, bei denen sie selbst am schlechtesten abschneiden. Ebenda: S. 20.
[5] Die Aussage von Hamacher, der zufolge eine Lehre, die besagt, ein Leben dürfe nicht angetastet, verletzt oder getötet werden, mit genau diesem Wunsch rechnet und ihn erhält, indem sie nicht aufhört, an ihn erinnern, trifft auch auf den hier vorliegenden Kontext zu. W. Hamacher, Sprachgerechtigkeit. Frankfurt am Main 2018: S. 130.
[6] Für Deleuze, dessen Aussage hier quasi gekehrt wird, wird „dies vielleicht das Wichtigste sein.“ G. Deleuze, Unterhandlungen 1972-1990. Frankfurt am Main 1993: S. 252.
[7] Deleuze äußert sich im Buch über Foucault wie folgt: Was das wirklich Gesagte anbetrifft, so rührt seine faktische Knappheit einzig von dem her, was ein Satz an anderen negiert, an ihnen hemmt, worin er anderen Sätzen widerspricht oder womit er sie verdrängt; so dass jeder Satz noch von dem erfüllt, was er nicht sagt, von einem virtuellen oder latenten Inhalt, der seinen Sinn vervielfacht und der sich zur Interpretation anbietet und einen „verborgenen Diskurs“ von wahrhaftem Reichtum bildet. G. Deleuze, Foucault. Frankfurt am Main 1987: S. 11.