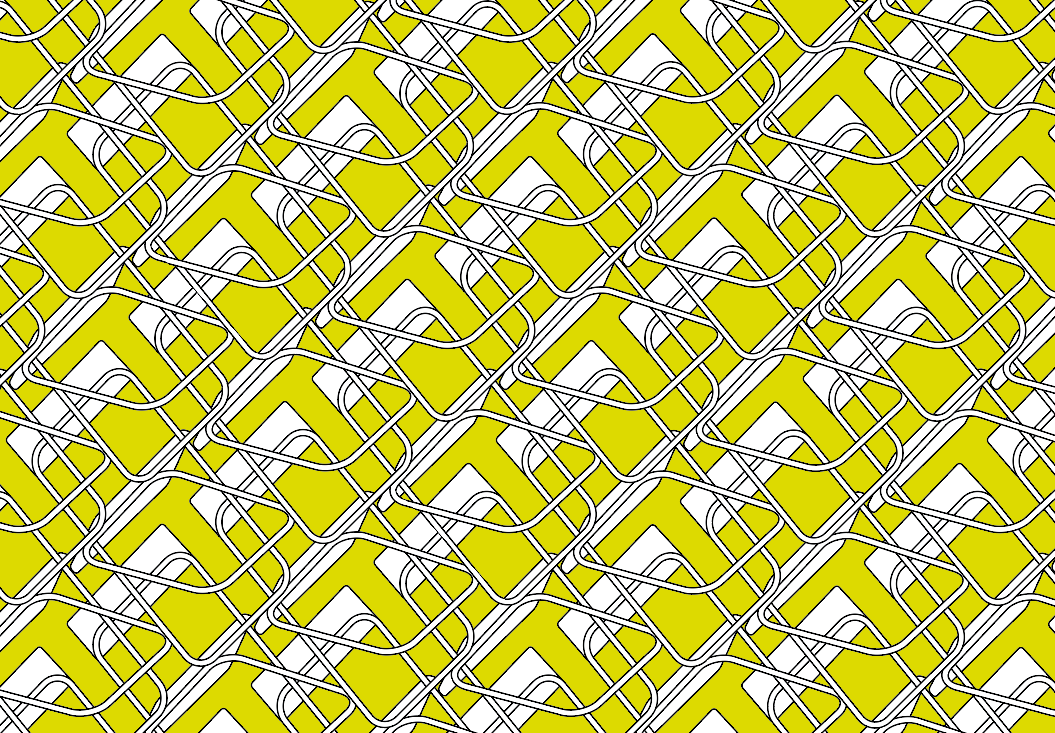Greta Thunberg will, dass die Alten Panik haben, Rezo mit seinen Videos die CDU zerstören. Den Jungen reicht’s! Und was machen die Alten? Schauen blöd aus der Wäsche. Was ist da los? Erleben wir einen Generationenkonflikt neuen Ausmaßes? Oder geht es um etwas ganz anderes – um einen Streit zweier Perspektiven in uns selbst?
Text: Rebekka Reinhard, Thomas Vašek
Mitarbeit: Maja Beckers
In der Fußgängerzone einer Großstadt. Man reiht sich in die Herde der Window-Shopper ein. Vor einem: eine Figur in Kapuzenshirt, Jeans im Destroyed-Look und Yeezy-Sneakers, die Ohren mit Earpods verstöpselt. Jeder kennt diese Szene, diese Gestalt. Solange sie einem den Rücken zuwendet, sind Alter und Geschlecht unklar. Ist es ein 20-jähriger Student? Oder ein jung gebliebener 50-Jähriger? Eine Working Mom auf dem Weg ins Yogastudio?
Auf den ersten Blick lassen sich Alt und Jung heute nicht mehr so leicht unterscheiden. Die Lebensformen wie auch die Moden ähneln sich, erst recht die digitalen Devices. Mit dem Smartphone laufen heute alle herum. Andererseits scheint sich zwischen den Generationen eine Kluft aufzutun. Die Alten haben oft das Gefühl, mit den Jungen nicht mehr mitzukommen.
Wozu braucht man Snapchat? Was ist das Tolle am Zocken von Computergames, an der Manga-Kultur, am Instagram-Profil von Selena Gomez? Was soll plötzlich cool daran sein, seinen Sohn Hugo oder Karl zu nennen, sich die Haare grau zu färben oder sich mit der FaceApp digital älter zu machen, als man ist?
Jung gilt heute immer erst mal als hip – alt hingegen als langweilig, überkommen, gestrig. »Das ist so alt«, sagen wir, wenn wir etwas abwerten. Nicht nur junge Feministinnen sprechen mittlerweile von »alten weißen Männern«, wenn sie Sexismus anprangern wollen. Junge Start-up-Unternehmer spotten über die »Old Economy», wenn sie starre, hierarchische Strukturen meinen. »Alt« heißt heute nicht mehr »weise«, sondern »dement«.
Generationenkonflikte gab es in der Moderne schon immer. Vom Sturm und Drang bis zu den 68ern: Stets rebellierten die Jungen gegen die Alten – gegen ihre Politik, ihren Lebensstil, ihre Werte. Sie konfrontierten die Elterngeneration mit ihren Mängeln und Schwächen und riefen zum Aufbruch auf. Umgekehrt ermahnten die Alten die Jungen immer schon zu Vernunft, Moral und Sitte. Und stets mobilisierten sie all ihre konservativen Beharrungskräfte, um die alte Ordnung zu verteidigen. Das alles sind keine neuen Phänomene.
Neu ist aber die Verherrlichung der Jugend als Paradigma von Innovation und Zukunftsfähigkeit. Neu ist auch, dass es in Europa immer mehr Alte und immer weniger Junge gibt. Neu ist aber vor allem, dass die Jungen heute überall mitreden, gehört und ernst genommen werden wollen – und dass sie es, dank digitaler Technologien, auch können. Das Mathe-Abitur zu schwer? Einspruch! Uploadfilter zum Schutz des Urheberrechts? Nicht mit uns! Wahlrecht erst ab 18? Geht gar nicht!
Das derzeit sichtbarste Zeichen der neuen Jugendmacht ist die »Fridays for Future«-Bewegung, die die »alten« Politiker reihenweise in Erklärungsnot bringt. Die heutigen Jungen lassen sich nicht mehr mit Leerformeln abspeisen. Von klein auf gewöhnt, in ihren Bedürfnissen wahrgenommen zu werden, fordern sie die Erfüllung ihrer Wünsche ganz selbstverständlich ein. Nie zuvor haben die Jungen in der westlichen Welt so viel Wohlstand und Komfort genossen wie heute. Zu den überraschendsten Einsichten gehört, dass sie nicht einfach zu konsumistischen »Smombies« (Smartphone-Zombies) mutiert sind, sondern die Welt retten wollen und dafür auch auf die Straße gehen – dass sie politischer sind als die eigenen Eltern.
Jung blickt nach vorn, Alt zurück
Einerseits sind die Jungen verwöhnt, andererseits haben sie ein besonderes Maß an sozialer Kompetenz und Empathie ausgebildet. Sich politisch engagieren? Klar! Aber nur, wenn ich mich emotional geborgen fühle, wenn ich denen, mit denen ich gemeinsame Sache mache, vertrauen kann, wenn sich die Sache authentisch anfühlt.
So oder ähnlich sehen viele empirische Befunde zur heutigen »Generation Z« aus. Einschlägige Untersuchungen ebenso wie Titelgeschichten in Magazinen muten wie die Besichtigung einer fremden Spezies an, die man bestaunen und erforschen kann, die aber nicht viel zu tun hat mit der Lebensform der Älteren. Aber könnte man es nicht auch ganz anders sehen? Sind uns nicht viele scheinbar so fremde Eigenarten der »Gen Z« vertrauter, als wir denken – auch weil wir sie selbst in uns tragen?
In philosophischer Hinsicht stellt sich die Frage, was die Begriffe »alt« und »jung« überhaupt bedeuten – und ob wir sie nicht noch ganz anders verstehen können als bloß im biologischen Sinn. Das Alter ist mehr als nur ein »stufenweises Zurücktreten aus der Erscheinung«, wie Goethe schrieb. Es ist auch eine stufenweise Veränderung der zeitlichen Perspektive. Je älter man wird, desto mehr Zeit liegt hinter einem, desto weniger bleibt einem.
Schon deshalb schauen die Älteren tendenziell zurück, während die Jungen nach vorn schauen. Auch wenn ein älterer Mensch vom Klimawandel betroffen ist, so ist es wahrscheinlich, dass er dessen krasse Auswirkungen nicht mehr selbst erleben wird. Wie mit dem Klimawandel ist es auch bei anderen Zukunftsthemen. Wer heute im Rentenalter ist und womöglich mit einer chronischen Krankheit kämpft, wird diese Themen nicht so unmittelbar wahrnehmen wie ein 20-Jähriger, dessen zukünftige Lebenschancen davon abhängen.
Jung blickt nach vorn, Alt zurück. Die Alten haben ihre Erinnerungen und Erfahrungen. Sie haben vieles schon getan, versucht, erlebt. Sie haben ihre Ziele erreicht oder verfehlt, ihre Chancen genutzt oder verpasst. Mit anderen Worten, sie haben einen großen Teil ihres Lebens schon gelebt. Das macht sie zwar nicht zwangsläufig klüger oder gar weiser. Aber es unterscheidet ihren Blick auf die Welt von jenem der Jungen, die noch alles vor sich haben.
Wer die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, der sieht nicht notwendig verschiedene Dinge, aber er sieht sie anders. Für den Alten, der noch die Zeit des Wirtschaftswunders erlebt hat, mag das eigene Auto ein Symbol für Freiheit und Wohlstand sein. Für viele Junge ist es ein Klimakiller, der die eigene Zukunft zerstört.
Wann immer es dem Neuen, Ungewohnten begegnet, greift Alt in die Erfahrungskiste.
Die unterschiedlichen Blickrichtungen bedingen auch unterschiedliche Befindlichkeiten, die ausschlaggebend sind für das, was Menschen tun oder nicht tun. Wer alles noch vor sich hat, mag naiv sein, aber er hat auch das Zeug, zum Helden zu werden. Wer alles noch vor sich hat, kann experimentieren und noch zehnmal die Karre an die Wand fahren, weil noch Zeit bleibt, es anders besser zu machen.
Angstlust (siehe auch HOHE LUFT 6/2018) ist das Gefühl von »jung« – ein emotionales Hybrid, dass einen eben das suchen lässt, was man fürchtet. Den Thrill einer Existenz, die für alles offen ist. Für die Gefahr, den Schmerz ebenso wie den überschäumenden Enthusiasmus. Demgegenüber steht die Abgeklärtheit von »alt«: Wann immer es dem Neuen, Ungewohnten begegnet, greift Alt in die
Erfahrungskiste: schon mal gehört, schon mal gefühlt, alles schon mal da gewesen. Wo Jung die Ambivalenz sucht, will Alt die Eindeutigkeit.
Auch ein Junger kann satt sein, ohne je Hunger verspürt zu haben
Generationenkonflikte haben heute nur wenig mit »links« oder »rechts« zu tun, sondern eher mit Dichotomien wie »beweglich« oder »starr«, »offen« oder »geschlossen«, »hungrig« oder »satt«. Schon deshalb kann man das Alt/Jung-Schema nicht auf die Biologie reduzieren. Dass jemand nur noch wenige Jahre zu leben hat, muss nicht heißen, dass er nichts mehr vorhat. Und dass er auf viele Jahre zurückblicken kann, muss nicht heißen, dass er über einen reichen Erfahrungsschatz verfügt. Umgekehrt kann auch ein Junger wenig vorhaben und satt sein, ohne je hungrig gewesen zu sein – weil er das Gefühl hat, ohnehin schon alles Wichtige »abgehakt« zu haben: sexuelle Experimente, Partnerschaft, Auslandsaufenthalt, erster Job, erstes Kind.
Doch zwischen »jung« und »alt« gibt es auch eine entscheidende Asymmetrie: Während auch der Alte mutig, naiv und angstlustig sein kann, kann der Junge nicht erfahren sein, auch wenn er noch so viel erlebt hat. Denn eine entscheidende Erfahrung fehlt ihm notwendigerweise: die Erfahrung, schon viele Jahre auf der Welt gewesen zu sein, älter zu werden, dem Tod näher zu rücken.
Den biologischen Verfallsprozess mag zwar jeder anders empfinden. Doch die Erfahrung des Älterwerdens machen wir alle – erleben sie an uns selbst und an anderen. Dazu gehört eine schrittweise, oft demütigende Depotenzierung in einem doppelten Sinn: Wir verlieren Möglichkeiten und Optionen ebenso wie unsere schiere Lebenskraft.
Nicht jede Entscheidung lässt sich revidieren, nicht jede verpasste Chance erneuern, nicht jeder Fehler wiedergutmachen. Zugleich brauchen wir mit zunehmendem Alter immer längere Erholungs-, Heilungs- und Lernphasen, wir müssen uns immer mehr anstrengen, um auf dem gleichen Stand zu bleiben, während unsere Zeit immer weniger wird. Älter zu werden heißt auch, langsamer zu werden, nicht mehr so leicht mitzukommen, nicht mehr alles mitzukriegen, von anderen überholt zu werden.
Solange wir »jung« sind, entfalten wir immer neue Facetten unserer Person, wir verpuppen und verwandeln uns, werden immer »neu«, bis wir irgendwann meinen, »gereift« zu sein – und auch noch den Erwartungen anderer an unsere Reife, unser »Erwachsensein« entsprechen zu müssen. Wir erstarren in unserer Rolle, wir verschließen uns, wir meinen, endlich irgendwo »angekommen« zu sein. Mit anderen Worten: Wir werden alt. Das kann mit 60 oder mit 30 der Fall sein – bei manchen vielleicht auch nie.
Als der YouTuber Rezo in seinem Video die »Zerstörung der CDU« ausrief, erreichte er nicht nur mehr Aufmerksamkeit als jeder Leitartikel. Mit seinem maschinengewehrartigen Stakkato-Ton und den schnellen Schnitten ließ er die ganze alte Politik noch älter aussehen. Und die Versuche mancher Zeitungen, Rezo faktische Fehler nachzuweisen, wirkten trotz aller Berechtigung irgendwie vergreist. Ob und inwieweit der YouTuber mit der blauen Tolle recht hatte oder nicht: Sein Video war eine gelungene Performanz von Schnelligkeit und Kraft.
Als die 16-jährige Greta Thunberg antrat, um mit Gleichgesinnten für die Rettung des Planeten zu kämpfen, hatte sie weder eine Parteimitgliedschaft noch ein Studium oder Berufserfahrung. Sie brauchte keinerlei Qualifikation, ihre Überzeugungskraft und Entschlossenheit reichten aus.
Jung gehört die Macht, weil Jung die Zukunft gehört – die Kraft und die Schnelligkeit.
Rezo und Greta wären wohl niemals so erfolgreich geworden ohne die sozialen Medien, die ihre Kraft nur noch weiter potenzierten. Das Netz ist nicht nur das Medium, in dem sich die Jungen ausdrücken. Es ist auch das Mittel, mit dem sie die Alten das Fürchten lehren.
Der vermeintliche Konflikt zwischen Alt und Jung entzündet sich in Wahrheit nicht – oder nicht nur – zwischen einander verständnislos gegenüberstehenden Generationen. Er flammt überall dort auf, wo es um Macht geht. Mit zunehmender Depotenzierung von Alt wird klar: Jung gehört die Macht, weil Jung die Zukunft gehört – die Kraft und die Schnelligkeit. Daran können auch sämtliche Machtpositionen nichts ändern, die Alt im Laufe der Zeit besetzt hat.
Von dieser Ohnmacht kann sich Alt nicht mehr erholen. Daraus erwächst seit jeher der Neid von Alt auf Jung. Das kennt jeder von uns aus eigener Erfahrung. Die Alten sind empört, dass da ständig Jüngere nachkommen – und einfach machen: Was, meine Vorgesetzte ist zehn Jahre jünger als ich? Wie, mein junger Nachbar kriegt schon ein Kind, während ich wohl nie eins haben werde? Und warum hat mein Neffe schon wieder eine Weltreise gemacht?
Wer sich alt fühlt, sollte sich daher nicht fragen: warum? Sondern: Auf wen bin ich neidisch? Sollte sich herausstellen, dass es immer das Junge ist, über das ich mich empöre, das ich begehre, dem ich schlimmstenfalls übelwill, ist es Zeit, den Blick nach innen zu richten. Vielleicht beneidet mein älteres Selbst mein früheres, jüngeres. Vielleicht aber ist dieses jüngere Selbst noch höchst lebendig, nur gefangen in meinem älteren, das die Macht partout nicht abgeben will. Vielleicht ist mein älteres Selbst nur zu bequem, sich auf die Zumutungen und Dreistigkeiten des jüngeren einzulassen.
Faktisch gäbe es ohne das Ende von alt kein jung
Auch wenn die wilde, ambivalente Angstlust unter der dicken Kruste der Abgeklärtheit verborgen scheint – sie könnte jederzeit hervorbrechen. Dass dies geschieht, hängt bei Weitem nicht allein von unserem autonomen Willen zur Veränderung ab. Sondern auch an Situationen, Kontexten, Momenten des Lebens, die nicht planbar sind. Die überraschend eintreten und uns zwingen, »das Andere« in uns zu neuem Leben erwachen zu sehen. Das kann ein überraschender Schicksalsschlag sein genauso wie eine überraschende Wendung in der Abfolge existenzieller Ereignisse, von der wir glaubten, sie seien gesetzt. Sie sind es, die uns von einem Moment auf den anderen »verjüngen« können. Wie nachhaltig diese durchs Leben bewirkte »Verjüngungskur« ist, ist allerdings eine Frage der (neuen) Gewohnheiten, die wir uns in der Folge zu eigen machen.
Wir leben weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft. Leben ist immer jetzt, für die Jungen wie für die Alten. Es ist der Punkt, in dem sich die zwei Blickrichtungen berühren, der Blick zurück und der Blick nach vorn. Derselbe Baum in der Nachbarschaft erzählt für den Alten eine Geschichte voller Erinnerung, für den Jungen ist er vielleicht der Ort, wo er seine Kumpel trifft und sein Fahrrad parkt. Erst beide Blickwinkel zusammen ergeben ein lebendiges Jetzt, in dem vergangene und künftige Möglichkeiten enthalten sind.
In welcher Welt wollen wir leben? In einer Welt, in der sich »alt« und »jung«, »starr« und »beweglich«, »satt« und »hungrig« und »offen« und »verschlossen« feindlich gegenüberstehen, zwischen den Menschen und im einzelnen Menschen selbst? Oder in einem lebendigen Jetzt, in dem all diese Pole dynamisch zusammenwirken, statt sich wechselseitig zu neutralisieren? Dieses Zusammenwirken erreichen wir aber nicht, indem wir nur darüber philosophieren. Wir brauchen gemeinsame Räume, Foren und Institutionen, analog wie digital, in denen sich die Alten und die Jungen, die Beweglichen und die Starren, die Satten und die Hungrigen vermischen. Wo dieselben Themen und Probleme aus junger und aus alter Sicht diskutiert und praktisch angegangen werden.
Die Voraussetzung dafür ist Neugier auf beiden Seiten – die Neugier aufeinander. Der Alten auf die Jungen, die sie selbst einmal waren. Und der Jungen auf die Alten, die sie so oder so ähnlich einmal sein werden. Wirklich »alt« sehen jene aus, die überhaupt keine Neugier mehr entfalten können oder wollen, die sich auch nicht öffnen für staunenswerte, überraschende Situationen.
Gerade für die Alten mag es schwierig sein, mit ihrer Depotenzierung fertigzuwerden, ihre Macht den Jüngeren abzutreten. Faktisch aber gäbe es ohne das Ende von alt kein jung. Indem der Alte die Macht an die Jungen abgibt, vollzieht er seinen letzten jungen Akt. Er zeigt, dass er hungrig ist: auf eine Zukunft, die nach ihm kommt und weitergeht, immer weiter.
Dieser Text erschien zuerst in HOHE LUFT 6/2019